Artikel
Dies ist eine kleine Auswahl von Artikeln, die ich für verschiedene Zeitschriften geschrieben habe, z.B. für "BIO", "Esotera", Natürlich" u.a.
Inhaltsverzeichnis
- Wir leben nicht in Darwins Welt
- Wunder - Wende - Wassermann: Zeichen einer Neuen Zeit?
- Mind over Matter - der Geist beherrscht die Materie
- Du lebst nur einmal - und zwar für immer
- Hilf mir, es selbst zu tun - Maria Montessoris pädgogische Alternativen
- Sonne, Mond und Sterne - kosmische Helfer im Garten: Die Forschungen und Erfahrungen der Gärtnerin Maria Thun
- Gentechnologie - Horror, Hoffnung oder Hirngespinst?
Kooperation statt Kampf - ein Plädoyer für eine neue Sicht der Evolution
© Reinhard Eichelbeck
(erschien in etwas geänderte Fassung 2001 in “Zeitpunkt”, Heft 55)
Im November 1859, vor fast 150 Jahren, veröffentlichte Charles Robert Darwin (1809-1882) sein Buch “Über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion”, in dem er die Entwicklung der Lebewesen auf unserem Planeten - wir nennen das heute Evolution - nicht mehr durch das Wirken einer höheren schöpferischen Instanz, sondern durch einen blinden und unintelligenten Mechanismus erklärte.
Dieses Denkmodell aus der Dampfmaschinenzeit - das sich mittlerweile zu einem materialistischen Schöpfungsmythos aufgebläht hat, wo “Mutation” und “Selektion” als allmächtige Götter agieren - gilt heute vielen Wissenschaftlern und Laien immer noch als die einzig akzeptable Theorie über den Ablauf der Evolution. Seine Schlagworte, wie z.B. “Natürliche Selektion”, “Kampf ums Dasein” (struggle for life) und “Überleben des Tüchtigsten” (survival of the fittest) sind in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Und immer wieder ist zu lesen, dieses Denkmodell sei “gesichert” oder sogar “vollgültig bewiesen”.
Aber das ist der Darwinismus keineswegs. Im Gegenteil - er ist bis heute unbewiesen, er ist in sich widersprüchlich und teilweise unlogisch, er geht von falschen Voraussetzungen aus und er steht in vielen wichtigen Punkten im Gegensatz zu den bekannten Erfahrungstatsachen. Er ist, so erkannte der Schweizer Naturforscher Louis Agassiz schon 1860, ein “wissenschaftlicher Missgriff, unlauter hinsichtlich der Fakten, unwissenschaftlich in den Methoden und schädlich in der Tendenz”.
Für Darwin war der Krieg (“war of nature”) der Vater der Evolution, wo “die Stärksten siegen und die Schwächsten erliegen”. Aber diese Erkenntnis hat er nicht aus der Naturbeobachtung bezogen, sondern aus der Gesellschaftsphilosophie seines Landsmannes Thomas Malthus. Und damit hat Darwin sozialneurotische Unarten des Menschen - Egoismus, Aggressivität, Rücksichtslosigkeit, Geilheit, die alten Macho-Untugenden, möglichst viele Nachkommen und möglichst viele tote Feinde zu hinterlassen - als naturgegeben, ja sogar als Grundprinzipien der Evolution dargestellt. Wohin eine solche Haltung führt, zeigen uns heute die politischen und ökologischen Katastrophen der Gegenwart.
All jene als Politiker verkleideten Machtneurotiker vom Schlage eines Milosevic oder Saddam Hussein, die Minderheiten zu unterdrücken oder sogar auszuradieren versuchen, können sich heute zu ihrer Entschuldigung auf Darwin berufen: denn er hat die Ausrottung (“extermination”) und Auslöschung (“extinction”) der Schwachen durch die Starken zum Grundprinzip des Lebens in der Natur erhoben - und zur treibenden Kraft in der Evolution.
Aber die darwinistische Sicht der Natur ist falsch - das wird heute durch eine Fülle von Indizien aus der Naturbeobachtung belegt. Nicht Kampf, sondern Kooperation, nicht hemmungslose Vermehrung, sondern situationsbezogene Selbstbegrenzung, nicht chaotische Zufälle sondern intelligente, schöpferische Ordnungsprozesse: das sind die wahren Grundelemente der Evolution - und allemal auch eine bessere Basis für die menschliche Gesellschaft, als Krieg und “survival of the fittest”.
Bei genauer Betrachtung findet man nur zwei Arten von Lebewesen auf unserem Planeten, die sich durch und durch darwinistisch verhalten: das eine ist der Mensch, das andere die Krebszelle. Beide vermehren sich völlig hemmungslos und ohne Rücksicht auf das größere Ganze, von dem sie ein Teil sind. Der Mensch, der sich “darwinistisch” verhält, ist wie ein Krebsgeschwür im Organismus der Erde, und wenn er so weitermacht, zerstört er seine eigenen Existenzgrundlagen.
Wir sind an einem Scheidepunkt angekommen, und unsere Zivilisation wird keine Zukunft haben, wenn wir nicht lernen, unsere Konkurrenzideologie abzulegen und kooperativ zu denken und zu handeln. Wir brauchen jetzt dringend neue ökologische, ganzheitliche und vor allem konstruktive Denkmodelle, die uns helfen, die Fehler der Vergangenheit rückgängig zu machen - soweit es geht - und Zukünftige nach Möglichkeit zu vermeiden.
Der Darwinismus scheint mir ein ganz wesentliches Hindernis für diesen notwendigen Prozess des Umdenkens zu sein, und daher halte ich es für wichtig, dass wir uns so bald wie möglich von ihm verabschieden. Dass er sich - bei näherer Betrachtung - weder im naturwissenschaftlichen noch im philosophischen Sinne als überzeugend erweist, sollte uns diese Entscheidung leicht machen.
Ein Jahrhundertirrtum
Was stimmt nun aber nicht an diesem Denkmodell, das ich für den größten wissenschaftlichen Irrtum der Neuzeit halte?
Zu Darwins Zeiten war das mehrheitlich anerkannte Denkmodell der schulwissenschaftlichen Biologie über die Herkunft des Lebendigen die biblische Schöpfungslehre: die verschiedenen Arten von Lebewesen waren einmalig und unveränderlich von Gott geschaffen.
Darwins Auffassung, dass alle Lebewesen miteinander verwandt sind und von (einem oder mehreren) gemeinsamen Vorfahren abstammen, war zwar ketzerisch, aber nicht neu. In Ansätzen tauchte dieser Gedanke beispielsweise schon bei Kant und Goethe auf und bei Darwins Großvater Erasmus - definitiv ausformuliert findet er sich 1809 bei Lorenz Oken und Jean Baptiste de Lamarck. Eine erstaunliche Synchronizität: im gleichen Jahr wie Charles Darwin erblicken die beiden ersten wissenschaftlichen Evolutionsmodelle das Licht der Welt.
Was die Abstammung angeht, so ist es offensichtlich, dass wir von Eltern abstammen, die wiederum von Eltern abstammen, die wieder von Eltern abstammen undsoweiter bis zu den ersten Menschen. Die wiederum müssen von “Vormenschen” abstammen, die von “Vorsäugetieren” abstammen, die von “Vorreptilien” abstammen, die von “Voramphibien” abstammen, die von “Vorfischen” abstammen, die von “Vorwasauchimmer” abstammen, bis hinunter zum Urschleim oder noch weiter. So jedenfalls legen es uns die versteinerten Zeugnisse früherer Lebewesen und die Erkenntnisse der Paläontologie nahe.
Nach aller Erfahrung entsteht das Lebendige immer nur aus dem Lebendigen - omne vivum ex vivo - und die Kette des Lebens darf nicht unterbrochen werden. Wie aber hat man sich die Übergänge vorzustellen - von Was-auch-immer zu Fisch, von Fisch zu Fleisch und schließlich zu Mensch? Es hat offenbar im Laufe der vergangenen 500 bis 600 Millionen Jahre dramatische Veränderungen in der Gestalt der Lebewesen gegeben - aber wer oder was hat sie verursacht?
Charles Darwin ist in seinem Evolutionsmodell von 1859 davon ausgegangen, dass alle Lebewesen sich ungehemmt vermehren - sein erster großer Irrtum - weil ihnen “keine vorsichtige Enthaltung vom Heiraten” möglich ist und dadurch ein gewaltiger “Bevölkerungsüberschuss” entsteht. Demzufolge herrscht in der Natur ein heftiger Krieg (“war of nature”), ein ständiger “Kampf ums Dasein” (“struggle for life”) bzw. um Nahrung und Lebensraum. Dieser Kampf ist - so Darwins zweiter großer Irrtum - besonders heftig zwischen Angehörigen der gleichen oder einer nahe verwandten Art.
Wenn nun ein Lebewesen durch irgendeine erbliche Veränderung einen Vorteil im Kampf ums Dasein bekommt, sagt Darwin, wird es sich durchsetzen, stärker vermehren und die schwächeren Artgenossen verdrängen: “die Stärksten siegen und die Schwächsten erliegen”.
Diesen Vorgang nannte Darwin “natural selection” (natürliche Selektion), später verwendete er alternativ dafür auch den von Herbert Spencer übernommenen Begriff “survival of the fittest” (Überleben des Tüchtigsten). Und er glaubte, dass dieser Prozess, indem er über sehr lange Zeiträume hinweg schrittweise kleinste Verbesserungen akkumuliert, die Grundlage der Evolution bildet - Darwins dritter großer Irrtum.
Was den zuerst genannten Irrtum angeht, so wissen wir heute, dass Darwins Annahme, dass es in der Natur keine “Geburtenkontrolle” gibt, falsch ist. Im Gegensatz zur menschlichen Gesellschaft gibt es in der Natur eine Fülle von Mechanismen, die eine zu starke Vermehrung einzelner Arten verhindern. Es gibt soziale Mechanismen (wie das Revierverhalten der Vögel zum Beispiel), es gibt hormonale Mechanismen (bei den Bibern und vielen anderen Säugetieren beispielsweise, wo bei Überbevölkerung das Fruchtbarkeitsalter der weiblichen Jungtiere später eintritt), es gibt von außen eingreifende Mechanismen, wie Fressfeindschaft oder Seuchen, es gibt noch ungeklärte, aber offenbar effektive Mechanismen bis hin zu “Kollektivauswanderungen” wie bei den Lemmingen, die manchmal tödlich enden.
Tatsache ist, dass vor allem die höheren Lebewesen ihre Anzahl den Umweltbedingungen gemäß selbst bestimmen: eine Überbevölkerung und ein daraus resultierender gnadenloser “Kampf ums Dasein” werden vermieden.
Der Mythos von den “Selektionsvorteilen”
Da kein gnadenloser Kampf herrscht, gibt es auch keinen gnadenlosen “Selektionsdruck” - und damit entfällt auch der “Überlebensvorteil” von kleinsten Veränderungen. Dass komplexe neue Organe oder Merkmale - wie zum Beispiel der Vogelflügel aus einem Saurierbein - durch allmähliche Akkumulation solcher kleinster Veränderungen über lange Zeiträume hinweg entstehen, ist höchst unwahrscheinlich und es gibt dafür keine Beweise - weder in der Gegenwart noch in der Vergangenheit - ja nicht einmal überzeugende Beispiele, wie so etwas theoretisch ablaufen könnte.
Erstens ist es schwierig, sich vorzustellen, wie winzigste Anfänge eines neuen Merkmals oder Organs bereits einen solchen “Überlebensvorteil” darstellen könnten, dass sie ihrem Träger dazu verhelfen, sich durchzusetzen, sich mehr als seine Kollegen zu vermehren und diese zu verdrängen. Den Giftstachel einer Biene kann man sicherlich als einen “Überlebensvorteil” ansehen - aber wie sieht der erste, winzige Beginn eines solchen komplexen Merkmals aus? Und welchen “Überlebensvorteil” könnte er haben?
Es gibt stachellose Bienen, die, ebenso wie die Mehrheit der übrigen Insekten, durch ihre Existenz überzeugend demonstrieren, dass man auch ganz ohne Stachel bestens zurechtkommt.
Und das gilt auch für alle anderen Merkmale und Eigenschaften der mehrzelligen Organismen. Dass sie allesamt zum bloßen Überleben und zur Fortpflanzung nicht unbedingt nötig sind, zeigt allein schon die Tatsache, dass die überwältigende Mehrheit der Lebewesen auf diesem Planeten aus Einzellern besteht. Es gibt achtmal mehr Arten von Würmern, als es Arten von Säugetieren gibt. Wozu braucht es also Knochen? Oder eine Plazenta? Oder ein Gehirn? Unzählige hirnlose Lebewesen überleben erfolgreich seit Jahrmillionen - und im Deutschen Fernsehen ist Hirnlosigkeit derzeit geradezu ein entscheidendes Kriterium für Erfolg. Gehirn ist im Grunde ein überflüssiger Luxus - warum also entstand es überhaupt?
Es gibt in fast allen Biotopen fast alles, was an Eigenschaften, auch jeweils Gegenteiligen, nur denkbar ist. Wenn aber Größe ein “Überlebensvorteil” ist, warum gibt es dann Kleinheit? Wenn Schnelligkeit ein “Überlebensvorteil” ist, warum dann auch Langsame? Komplizierte und Einfache, Giftige und Ungiftige, Aggressive und Friedliche, Gepanzerte und Nackte, Getarnte und Ungetarnte - allesamt nur ein paar Schritte oder Hüpfer oder Flossenschläge voneinander entfernt?
Und vor allem: warum sind gerade Lebewesen mit Eigenschaften, deren “Überlebensvorteil” so offensichtlich ist, wie zum Beispiel Giftigkeit oder Tarnfärbung, so deutlich in der Minderheit? Die einfachste Antwort auf diese Frage ist: weil die Natur und die Evolution nicht nach darwinistischen Prinzipien verfahren.
Der Mythos von den “Zwischenformen”
Des weiteren kann man sich nur schwer vorstellen, wie über unzählige kleine Veränderungen, von denen dazu noch jede vorteilhaft sein soll, ein komplexes Organ entstehen, oder sich in ein anderes, noch Komplexeres verwandeln könnte. Wie verwandelt sich eine Flosse in ein Bein? Ein Bein in einen flugfähigen, befiederten Flügel? Wie Herz und Kreislauf eines Reptils in den eines Säugetiers? Wie sind aus Reptilschuppen Vogelfedern und Säugetierhaare entstanden?
Es kann sich nicht durch zahlreiche kleine Veränderungen, von denen jede ein flugfähiges Flugzeug ergeben soll, ein Propellermotor in einen Düsenantrieb verwandeln, weil es sich dabei um zwei völlig verschiedene Konstruktionen handelt. Ebensowenig konnte sich während der Evolution aus dem alten “Flugmotor” der Libellen - die es schon zur Karbonzeit gab - in vielen kleinen Schritten der modernere “Flugmotor” der Fliegen entwickeln: es sind ebenfalls zwei völlig verschiedene Konstruktionen.
“Ließe sich irgendein zusammengesetztes Organ nachweisen, dessen Vollendung nicht möglicherweise durch zahlreiche kleine aufeinander folgende Modificationen hätte erfolgen können, müsste meine Theorie unbedingt zusammenbrechen”, schrieb Darwin in der “Entstehung der Arten”.
Man könnte hier beinahe jedes “zusammengesetzte Organ” nehmen, denn sie alle sind erst funktionsfähig, wenn sie komplett sind - aber man braucht gar nicht erst bis zur Organebene gehen. Darwins Theorie bricht schon auf der molekularen Ebene zusammen. Die erste Zelle brauchte ein Mindestmaß an Komponenten um lebendig zu sein - ein allmählicher Übergang von unbelebten Molekülen zu ihr “durch zahlreiche kleine aufeinander folgende Modificationen” ist in der Praxis unmöglich.
Und das gilt beispielsweise auch für die Photosynthese, ein komplexer chemischer Prozess, der bereits zu Beginn der Evolution aufgetreten ist - um nicht zu sagen “erfunden” wurde. Er funktioniert nur, wenn alle Komponenten vorhanden sind, kann also ebenfalls nicht “durch zahlreiche kleine aufeinander folgende Modificationen” entstanden sein.
Es ist also kein Wunder, wenn man von den unzähligen Zwischenformen (“missing links”), die es nach Darwins Vorstellungen hätte geben müssen, keine Versteinerungen findet. In zahlreichen Aspekten stehen die steinernen Dokumente, wie der renommierte Paläontologe Otto Schindewolf es ausdrückte, “in schroffem Gegensatz zu der darwinistischen Deutung des stammesgeschichtlichen Geschehens”.
Das Fehlen der “missing links” begründen die Darwinisten heute damit, dass solche Übergangsformen sich in kurzer Zeit in kleinen, geographisch isolierten Populationen entwickelt und daher keine Spuren hinterlassen haben - aber das ist eine pure Spekulation.
Die Insel Neuseeland ist seit der Triaszeit, also seit über 60 Millionen Jahren isoliert, aber es haben sich dort weder besondere Neuerungen in der Tierwelt, wie zum Beispiel Säugetiere und moderne Reptilien, noch ein auffallender Formenreichtum entwickelt. Statt dessen finden sich dort “lebende Fossilien”, wie die Brückenechse, und die Fauna ist eher ärmlich im Vergleich zu nicht isolierten Gegenden, in denen sich im gleichen Zeitraum das gesamte Säugetierspektrum entwickelt hat.
Außerdem zeigen heutige Beobachtungen, dass in kleinen, isolierten Artgemeinschaften sich durch Inzucht Gendefekte einstellen, die gewöhnlich nach einiger Zeit zum Aussterben der betreffenden Population führen.
Und darüber hinaus wäre es doch zumindest auch sehr seltsam, wenn unter den vielen Versteinerungen, in allen Schichten, über 600 Millionen Jahre hin, eben gerade all die Geschöpfe nicht versteinert wurden, die das darwinistische Denkmodell stützen könnten. Da drängt sich schon ein bisschen der Verdacht auf, dass sie gar nicht existiert haben.
Der Mythos von den “Zufallsmutationen”
Ein weiteres Problem des Evolutionsverlaufs, das der Darwinismus nicht befriedigend erklären kann, ist die Frage, wie überhaupt neue Merkmale und Eigenschaften bei Lebewesen entstehen. Darwin sprach einfach von “Modifikationen”, deren Ursache er aber nicht weiter begründen konnte. Die Darwinisten des 20. Jahrhunderts haben inzwischen den Begriff “Modifikation” durch genetische “Mutation” und “Rekombination” ersetzt. Darunter verstehen sie zufällige, chaotische Übertragungsfehler bei der Zusammenstellung oder Weitergabe von Erbinformation, wobei sozusagen einzelne “Buchstaben”, “Wörter” oder ganze “Sätze” vergessen, hinzugefügt, ausgetauscht oder vervielfältigt wurden. Solche Fehler hätten zu Verbesserungen geführt, die “selektionsfähig” waren.
Dummerweise ist bis heute nicht völlig geklärt, welche Rolle die Gene bei der Formbildung tatsächlich spielen, und wie überhaupt Genveränderungen zu Gestaltveränderungen führen können.
Bei einigen Ameisen- und Termitenarten gibt es auffallende Unterschiede zwischen einzelnen Tieren - Arbeitern und Soldaten zum Beispiel - und doch haben alle die gleichen Gene. Bei einer Gallwespenart (Trigonaspis crustalis) unterscheidet sich die Wintergeneration derartig von der Sommergeneration, dass man sie lange Zeit für zwei verschiedene Gattungen gehalten hat.
Andererseits sind sich die Larven verschiedener Tierarten oft sehr ähnlich - selbst wenn sie unterschiedlichen Stämmen angehören - während zwischen der Larve und dem erwachsenen Tier große formale Unterschiede bestehen. Und auch Wirbeltierembryonen, von Fischen bis zu Menschen, sehen sich in einer frühen Entwicklungsphase so ähnlich, dass selbst Fachleute gelegentlich Schwierigkeiten haben, sie voneinander zu unterscheiden. Ungleiche Gene - ähnliche Form, gleiche Gene - unterschiedliche Form.
Prof. Dr. Walter Nagl, einem anerkannten Genetiker und Autor von Lehrbüchern über Genetik, sagte in einem Fernsehinterview: “Es weiß heute kein Mensch, wie aus einer Eizelle ein Organismus entsteht, warum aus einer Mauseizelle eine Maus wird und aus einer Menscheneizelle ein Mensch wird - die Gene sind fast gleich. Die Gene zwischen Menschenaffen und dem Menschen selbst sind zu 99,9 % identisch, und trotzdem sind wir ja verschieden, irgendwo. Also - da sieht man, dass man eigentlich den Kernpunkt nicht kennt, noch nicht erkannt hat, woran es liegt. Die Gene sind sicher der Faktor, der die Produkte liefert - aber erklären tun sie nichts, sozusagen.”
Davon abgesehen ist es aber auch vom logischen Standpunkt aus ganz und gar unsinnig anzunehmen, dass zufällige FEHLER zu Verbesserungen, zu ganz neuen Formen führen, und dass aus chaotischen Störungen kompliziertere und höhere Ordnungssysteme entstehen. Normalerweise - so formulierte es der Physiker Erwin Schrödinger - “entsteht Ordnung aus Ordnung”. Und dieser Satz wird durch all unsere Erfahrungen bestätigt.
Es gibt in der Natur, wohin man auch immer schaut, eine Fülle von Einrichtungen, die man - zwar menschlich gedacht, aber nicht unberechtigt - als “geniale Erfindungen” bezeichnet hat. Das beginnt mit der ersten lebendigen Zelle, die bereits, so Jacques Monod, “eine kleine Maschine von äußerster Komplexität und Leistungsfähigkeit” ist, setzt sich fort über Photosynthese, Arbeitsteilung und Differenzierung der Zellen beim Vielzeller, bis hin zu Sinnesorganen, Bewegungsorganen, und dergleichen mehr.
Da gibt es Ameisen, die sich Herden von Blattläusen halten und mit ihnen umherziehen, oder sich Pilzgärten anlegen, in denen sie ihre Nahrung züchten, Spinnen, die ihre Beute mit dem “Lasso” fangen, Vögel, die für ihren Balztanz eigens eine 300 Kubikmeter große und 10 Meter hohe Lichtung im Urwald anlegen, indem sie alle Blätter von den Bäumen abreißen, und Köcherfliegenlarven, die einen Klebstoff erfunden haben, der unter Wasser aushärtet. Da gibt es gelenkige Panzer, Scharnier- und Kugelgelenke, Haftapparate, Bohrer in verschiedensten Ausführungen, Injektionsspritzen, Kneifzangen, geniale Baustoffe und verblüffende Konstruktionen in Minimalbauweise.
Und all das soll durch zufällige Fehler beim Kopieren von Genen entstanden sein? Die Infrarotsensoren der Klapperschlangen und die elektrischen Organe der Fische? Die faltbaren Flügel der Käfer und die selbstreinigende Haut der Lotosblätter? Die genialen Spinnapparate der Webspinnen und ihr konstruktiver Instinkt?
Die Vorstellung, dass Veränderungen in einer Größenordnung, die aus einem Radio- einen Fernsehapparat machen, oder aus einer Postkutsche ein Auto, durch zufällige Fehler beim Kopieren des Bauplans entstanden sein sollen, ist schlicht und einfach absurd.
Anzunehmen, dass die Ordnung in einem System durch die Einführung von Unordnung - und nichts anderes ist ja eine “Zufallsmutation” - erhöht wird, ist ebenso sinnvoll wie die Annahme, dass ein Raum um so kälter wird, je mehr ich ihn heize.
Nicht Zufall und Chaos bestimmen die Richtung der Evolution, sondern intelligente, schöpferische Ordnungsprozesse. Es mag angehen, für kleine Veränderungen - beispielsweise bei den Schnäbeln von “Darwinfinken” oder den Gehäusen fossiler Schnecken - zufällige Mutation und Selektion verantwortlich zu machen. Auch wenn es dafür keine konkreten Beweise gibt, so ist dies doch theoretisch nicht unmöglich.
Aber für die unzähligen “genialen Erfindungen” der Natur, für die Benutzung gleicher Techniken bei ganz verschiedenen Lebewesen in ganz unterschiedlichen Umgebungen, für die Veränderung formaler Strukturen wie beispielsweise von Reptilien zu Säugetieren oder Vögeln, müssen wir eine höhere, schöpferische Intelligenz annehmen - da können der blinde “Zufall” und seine ebenso blinde Schwester “Selektion” uns beim besten Willen nicht mehr weiterhelfen.
Eine Katze, die über die Tasten eines Klaviers spaziert, könnte durchaus zufällig die Tonfolge G-G-G-ES treffen - den Anfang von Beethovens Fünfter Symphonie. Aber daraus nun zu schließen, dass sie die gesamte Symphonie zu Stande bringen würde, wenn sie nur lange und oft genug über die Tasten wandert, und dass sie, wenn sie nur genügend Zeit hat, auch noch zufällig sämtliche Klavierkonzerte des Meisters komponieren könnte - das ist abwegig.
Der Darwinismus kann die Evolution nicht erklären
Alles in allem müssen wir zu dem Schluss kommen, dass die entscheidenden Fragen der Evolution mit dem darwinistischen Selektionsmechanismus nicht befriedigend zu erklären sind.
Und das gilt auch für die sogenannten “Selbstorganisationstheorien”, die seit einiger Zeit von den Darwinisten diskutiert werden. All diese “Selbstorganisationsmodelle” erinnern fatal an die Geschichte vom Baron Münchhausen, der sich - samt Pferd - an seinem eigenen Zopf aus einem Sumpf gezogen hat. Oder an das amerikanischen Prinzip des “Bootstrapping”, wo man sich an den eigenen Stiefelschlaufen in die Höhe zieht. Ich habe allerdings noch niemand gesehen, der das geschafft hat, und solange ich es nicht mit eigenen Augen sehe, bin ich auch nicht bereit zu glauben, dass so etwas möglich ist.
Moleküle setzen sich nicht von alleine zu Zellen, Zellen setzen sich nicht von alleine zu Organen, und Organe nicht von alleine zu vielzelligen Organismen zusammen. Bei allen Ordnungsprozessen, die wir beobachten können, wird die Organisation immer von der höheren Integrationsebene aus gesteuert. Der Organismus baut sich aus Organen und Geweben auf, diese wiederum aus Zellen und diese wieder aus Molekülen - nicht umgekehrt. Von einer “zufälligen Selbstorganisation der Materie” kann keine Rede sein.
Der Darwinismus ist nur im ersten Augenblick einleuchtend, solange man nicht darüber nachdenkt oder ins Detail geht. Bei näherer Beschäftigung mit der Komplexität der Lebewesen, mit der technischen Genialität ihrer Organe und der subtilen Vielfalt ihrer Verhaltensweisen wird jedem, der nicht völlig der Darwinomanie verfallen ist, deutlich, dass dieses Denkmodell die Evolution nicht erklären kann.
Dies ist inzwischen auch vielen darwinorientierten Wissenschaftler klar geworden. In dem von Wolfgang Wieser herausgegebenen Band “Die Evolution der Evolutionstheorie” werden (auf Seite 251 ff.) nicht weniger als 21 Sachverhalte aufgeführt, die das darwinistische Evolutionsmodell in Frage stellen - aber die notwendige Konsequenz, nämlich zu sagen: das darwinistische Denkmodell ist falsch, lasst uns ein besseres finden - die wird leider nicht gezogen.
Auch der Herausgeber selbst schreibt in seinem einleitenden Artikel: “Genmutation und natürliche Selektion reichen nicht aus, um sämtliche Veränderungen der biologischen Evolution zu erklären.” Allerdings fügt er sogleich hinzu, dass die Liste der Kritikpunkte zwar eindrucksvoll sei, “ob sie jedoch ausreicht, um von einer Krise, ja vom ‘Ende’ des Darwinismus sprechen zu können (...) ist mehr als zweifelhaft.”
Höchst seltsam, dass selbst die Erkenntnis, dass er die Evolution nicht erklären kann, nicht ausreicht, um den Darwinismus aus den Köpfen seiner Anhänger zu vertreiben.
Nichtsdestoweniger kann man, so meine ich, nur immer wieder betonen: Darwin hatte Unrecht.
Nicht Arten- sondern Typenwandel ist das zentrale Phänomen und auch Problem der Evolution.
Nicht gradualistische Gleichförmigkeit bestimmte den Evolutionsablauf, sondern rhythmische Sprunghaftigkeit, gegliedert von globalen Katastrophen.
Nicht “Anpassung” der Lebewesen an die Umwelt, sondern ihre “Gestaltung” war es, die die Welt verändert und auf den heutigen Stand gebracht hat. Was die Evolution vorangetrieben hat, war die Erfindung von “Neuheiten” - Photosynthese, vielzellige Organismen, Kiefer und Zähne, Flossen, Beine, Flügel, Herz und Lunge, Nerven und Gehirn. Pure Anpassung - auch wenn sie noch so lange winzig kleine Veränderungen ansammelt - kann nichts Neues erfinden, im Gegensatz zur Meinung Darwins und der Darwinisten. Anpassung kann vielleicht Flossen perfektionieren, aber sie kann keine Beine daraus machen.
Und vor allem: es gibt eine funktionierende “Geburtenkontrolle” in der Natur, aber keinen “war of nature” oder “battle of life”. Der wesentlichste Faktor evolutiver Entwicklung ist nicht Kampf, sondern Kooperation - das ergibt sich sowohl aus der Erfahrung als auch aus logischen Überlegungen.
Kooperation statt Kampf
Die eigentliche große Zeit Evolution begann damit, dass Einzeller sich vor etwa 600 Millionen Jahren zu vielzelligen Organismen zusammenschlossen. Und dies ist eindeutig ein kooperatives Verhalten, das auch die Fähigkeit und den Willen zur Kommunikation voraussetzt.
Die “moderne” Zelle, Eucyte genannt, der Grundbaustein aller Vielzeller, ist nach heutiger Ansicht der Wissenschaft ursprünglich durch den Zusammenschluss verschiedener Einzeller entstanden.
Wer oder was auch immer die Vielzelligkeit bewirkt und die Eucyten geschaffen hat - es war jedenfalls ein Prinzip, das Kooperation im Sinn hatte, nicht Kampf. Und dieses Prinzip ist immer noch wirksam, und es war und ist der eigentliche Motor der Evolution - dies zeigt sich ganz eindeutig an ihrem Ergebnis: sie hat schließlich nichts geringeres geleistet, als den Aufbau und Ausbau eines ganzen Planeten. Von einem toten Steinklotz, wie man ihn von Bildern des Mars oder Merkur her kennt, zu einem blühenden, lebendigen Kunstwerk.
Ein ständiger “Krieg der Natur”, ein fortwährender “Kampf ums Dasein” kann derartiges nicht leisten. Jedes Geschehen, jeder Prozess, bei dem die Konfrontation die Kooperation überwiegt, ist destruktiv. Andererseits muss bei jedem Aufbauprozess die Kooperation stärker sein als die Konfrontation. Konkurrenz belebt nur dann das Geschäft, wenn sie in den Rahmen einer übergeordneten Kooperation eingebettet ist - sonst führt sie in den Ruin. Die Natur (oder die schöpferische Instanz, die sich hinter diesem Begriff verbirgt) hat das - im Gegensatz zu vielen Menschen - schon längst begriffen.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Not - in diesem Fall Nahrungsmangel - nicht zu einem gnadenlosen “Kampf ums Dasein” im darwinistischen Sinne führt, sondern durch eine kooperative Strategie überwunden wird, liefert eine unscheinbare Amöbe, der Schleimpilz Dictyostelium discoideum. Der Name Schleimpilz ist ein wenig irreführend, denn es handelt sich hier nicht um einen Pilz im üblichen Sinne, sondern um einzellige Amöben, die normalerweise jede für sich allein herumkriechen, Bakterien fressen und sich durch Teilung fleißig vermehren. Nichts besonderes im Reich der Einzeller. Ungewöhnlich ist nur ihre Reaktion, wenn die Nahrung knapp wird.
Sobald eine Amöbe zu hungern beginnt, sendet sie einen chemischen Botenstoff aus. Andere Amöben, die das Signal auffangen, geben es weiter, indem sie ebenfalls diesen Botenstoff produzieren. Wenn er eine bestimmte Konzentration erreicht hat, strömen alle Amöben im Umkreis zusammen - manchmal bis zu 100000 Stück - und formen ein schneckenartiges Gebilde.
Indem sie jetzt alle koordiniert und synchron handeln, bewegen sie sich wie eine winzige Nacktschnecke, von ihren Wärme- und Lichtsensoren geleitet, in Richtung auf einen warmen, sonnigen Platz. Dort formen sie eine Halbkugel, aus der ein Stil emporwächst, der dadurch entsteht, dass einige der Amöben sich aufrichten, verhärten und absterben, andere an ihnen emporklettern, sich ebenfalls verhärten und absterben undsoweiter.
Nachdem etwa 20 Prozent der Amöben sich so für die Allgemeinheit geopfert haben, klettert der Rest den Stiel empor, bildet einen Fruchtkörper und verwandelt sich in Sporen. Bei Gelegenheit platzt der Fruchtkörper auf, Wind oder Regen tragen die Sporen davon, in nahrungsreichere Gefilde, aus jeder Spore wird ein Amöbe - und das Spiel beginnt von neuem.
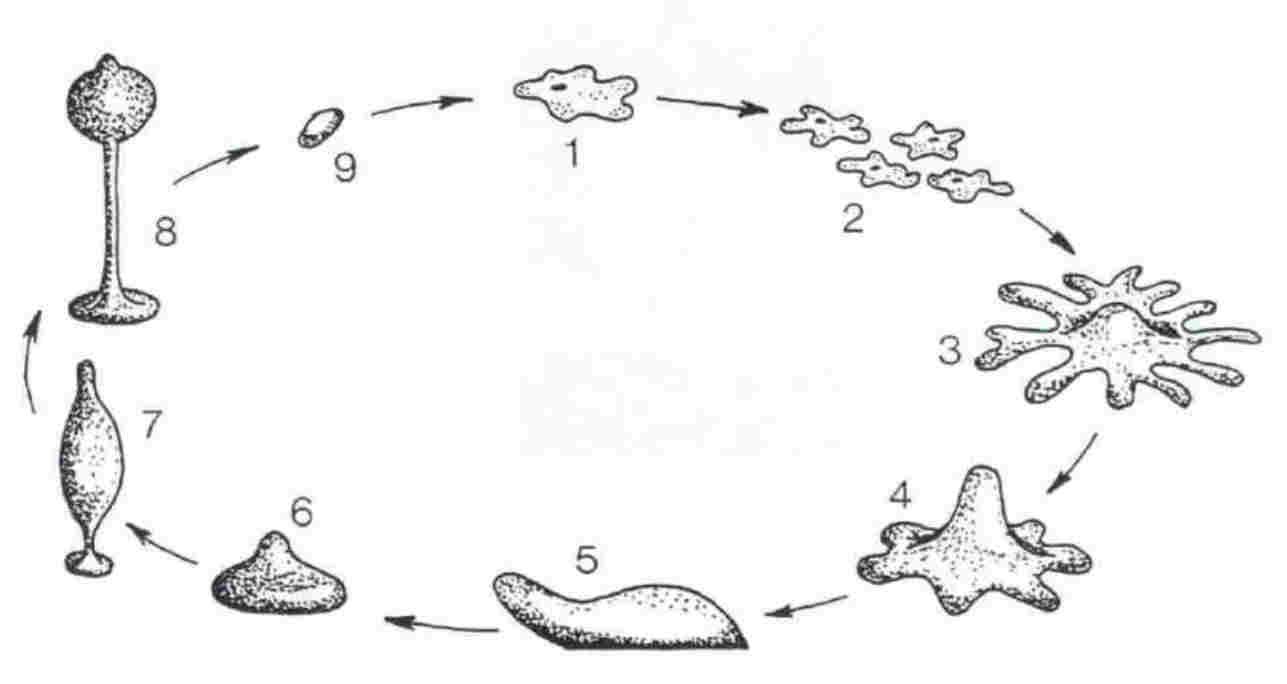
Lebenszyklus des Schleimpilzes Dictyostelium Discoideum:
1 einzelne Amöbe. 2 Wachstum und Vermehrung. 3-4 Versammlung. 5 Wanderung. 6-7 Aufrichtung. 8 Reifer Fruchtkörper. 9 Spore.
Hunger und Not führen hier also nicht zu einem darwinistischen “Kampf ums Dasein”, sondern werden durch eine kooperative Lösung, durch Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe - bis hin zum Opfer für die Allgemeinheit - überwunden.
Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel
Die Entwicklungslehre hatte ursprünglich eine stark emanzipatorische Komponente. Man wollte sich von der Bevormundung durch einen allmächtigen Schöpfer lösen, unabhängig sein, sich selbst verwandeln, entwickeln und aufsteigen. Freiheit und Selbstgestaltung war das Ziel. Davon ist heute nicht mehr viel übriggeblieben. Die Geschichte des Darwinismus ist auch eine Geschichte der schrittweisen Demontierung dieser emanzipatorischen Impulse.
Die biblische Schöpfungslehre vor Darwin machte den Menschen zum Sklaven göttlicher Willkür, er war von Gott geschaffen worden und hatte sich damit abzufinden. Nicht er selbst bestimmt sein Schicksal, sondern Gott. Der Darwinismus unserer Tage macht den Menschen zum Sklaven des Zufalls - er ist von Zufall geschaffen und hat sich damit abzufinden. Nicht er selbst bestimmt sein Schicksal, sondern seine Gene.
Das System ist das gleiche, nur die Namen haben sich geändert. Die Entwicklungslehre ist am Ende wieder da angekommen, wo sie vor ihrem Anfang war: in einer Philosophie, die den Menschen entmündigt. Und sie ist trostloser als die Vorherige, denn ihr ist der Bezug zu einer höheren geistigen Ebene unterwegs abhanden gekommen.
Sie hat den Menschen keine Freiheit gebracht, und der Wissenschaft auch nicht. Der Darwinismus ist zu einer Zwangsjacke geworden, unter der die Biologie erstickt. Die Notwendigkeit, alle Fakten - auch die, die beim besten Willen nicht hineinpassen - in diesem Denkmodell unterzubringen, hat zu seltsamen Gedankenkonstruktionen geführt, die eine Vergewaltigung der Vernunft darstellen. Und der Anspruch des Darwinismus, die endgültige und ein für alle Mal richtige Erklärung der Evolution zu sein, hat der Biologie ihre Zukunft genommen.
Aber dieses Denkmodell ist nicht die absolute Wahrheit, es ist nicht einmal eine wissenschaftliche Theorie, es ist eine Arbeitshypothese, die sich zu einem Schöpfungsmythos aufgebläht hat.
Der Zoologe Wilhelm Keferstein meinte schon Ende des 19. Jahrhunderts, der Darwinismus sei “der Traum eines Mittagsschläfchens”. Wäre es nicht langsam an der Zeit, aufzuwachen?
Charles Darwin hat sein Evolutionsmodell nicht aus der Naturbeobachtung bezogen, sondern aus der Gesellschaftsphilosophie seiner Landsleute Malthus und Spencer sowie aus den Erfahrungen zahlreicher Haustierzüchter, mit denen er korrespondierte. Tatsächlich enthält sein Hauptwerk “Über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion” kein einziges konkretes Beispiel für die Entstehung einer neuen Art durch natürliche Selektion in der Natur, sondern nur erfundene Beispiele und Spekulationen darüber, dass so etwas doch unter Umständen möglich sein könnte.
An einen seiner Enkel schrieb er: “Ich glaube an die natürliche Selektion, nicht weil ich in irgendeinem speziellen Fall beweisen kann, dass sie eine Spezies in eine andere verwandelt hat, sondern weil das (wie mir scheint) eine Reihe von Tatsachen der Klassifikation, der Embryologie, der Morphologie, der rudimentären Organe, der geologischen Abfolge und Verteilung ordnet und erklärt.”
Immerhin war er ehrlich genug, sein Denkmodell als eine “Hypothese” zu bezeichnen, und er schrieb in Bezug auf die “natürliche Selektion” als Evolutionsfaktor: “Ob dies alles aber wirklich stattgefunden hat, kann nur danach beurteilt werden, dass man zusieht, wieweit die Hypothese mit den allgemeinen Erscheinungen der Natur übereinstimmt und sie erklärt.” Darwins Nachfolger allerdings überprüften nicht die “Hypothese” an Hand der Natur, sondern die Natur an Hand der “Hypothese”, die sie inzwischen zu einer ewigen, unumstößlichen und absoluten Wahrheit hochstilisiert hatten. Ernst Haeckel: “Wer auch bei dem gegenwärtigen Zustande unseres Wissens immer noch nach Beweisen für die Selektionstheorie verlangt, der beweist dadurch nur, dass er entweder dieselbe nicht vollständig versteht, oder mit den biologischen Tatsachen, mit dem empirischen Wissensschatz der Anthropologie, Zoologie und Botanik nicht hinreichend vertraut ist.”
In der darwinistischen Literatur, inklusive der darwinfizierten Schulbiologiebücher wird immer wieder der Eindruck erweckt, als seien die Naturwissenschaftler von Anfang an und bis heute für Darwin gewesen, und nur altmodische Theologen, Kreationisten und verschrobene Ignoranten gegen ihn. Diese Darstellung aber ist falsch. Es waren von Anfang an bis heute gerade auch immer wieder Naturwissenschaftler (und darunter viele Biologen), die das darwinistische Evolutionsmodell kritisierten.
Der Schweizer Naturforscher Louis Agassiz - einer der kundigsten Paläontologen seiner Zeit - sah darin schon 1860 einen “wissenschaftlichen Missgriff, unlauter hinsichtlich der Fakten, unwissenschaftlich in den Methoden und schädlich in der Tendenz.” Damit traf er den Nagel auf den Kopf - weil er aber ein bekennender Christ war, unterstellte man ihm religiöse Gründe für seine Kritik und stempelte ihn zum Außenseiter.
Ähnlich verfuhr man mit dem Zoologen St. George Mivart, ebenfalls ein Zeitgenosse und Kritiker Darwins mit fundierten wissenschaftlichen Argumenten. Er bezweifelte (mit Recht) vor allem den selektiven “Nutzen der ersten rudimentären Anfänge” von neuen Merkmalen und Eigenschaften bei Lebewesen. Weil er zum Katholizismus übergetreten war, behaupteten Darwins Anhänger (insbesondere Huxley), er sei aus theologischen Gründen gegen Darwin und seine Argumente daher nicht ernst zu nehmen.
Ebenso verfuhr man in den 1980er Jahren mit dem Biologen Joachim Illies, der den Darwinismus als einen “Jahrhundertirrtum” bezeichnet hatte, und dem Chemiker Bruno Vollmert, der experimentell nachwies, dass in einer Ursuppenlösung keine langen Kettenmoleküle von Proteinformat zufällig von selbst entstehen können. Beide wurden wegen ihrer christlichen Grundhaltung angegriffen und diffamiert.
Alfred Russel Wallace, der gleichzeitig mit Darwin auf die Idee einer “natürlichen Selektion” gekommen war, bezweifelte später, dass sich alle Bildungen in der Natur auf diese Weise erklären lassen - insbesondere dachte er dabei an die menschliche Intelligenz, die für ihn weit über das zum Überleben nötige Maß hinausreichte. Um ihren Ursprung zu erforschen beschäftigte er sich auch mit Phänomenen wie Telepathie und Spiritismus - Grund genug für die Darwin-Fraktion, ihm zu unterstellen, er sei “geisteskrank geworden” (so Ernst Haeckel).
In dieser Tradition befand sich auch Richard Dawkins, als er von Darwinkritikern behauptete, sie seien “unwissend, dumm oder geisteskrank”. Und Ernst Mayr verbannte solche Leute ins Mittelalter, denn: “In Wahrheit aber ist jeder moderne Denker - jeder moderne Mensch, der eine Weltsicht hat - außer er hängt einem Schöpfungsglauben an und glaubt an die buchstäbliche Wahrheit eines jeden Wortes in der Bibel, letztendlich Darwinist.”
Naturwissenschaftliche Darwinkritiker, die nicht auf solche Weise diffamiert werden konnten, wurden totgeschwiegen. In keinem Schulbuch findet man die Namen von Männern wie Karl Wilhelm von Nägeli, Albert Wigand, Johannes Reinke oder Karl Eberhard von Goebel - allesamt Biologieprofessoren von Rang, die zwar die Idee einer Evolution bejahten, die darwinistische Evolutionserklärung jedoch als unzureichend ablehnten.
Der Embryologe Hans Driesch, der Paläontologe Otto Schindewolf, die Genetiker Richard Goldschmidt und Antonio Lima-de-Faria - sie alle wurden im Rahmen der darwinistischen Indoktrinierung im Laufe des 20. Jahrhunderts zu wissenschaftlichen Unpersonen degradiert - trotz (oder vielleicht auch gerade wegen) ihrer fundierten Argumente gegen Darwin und den Darwinismus. Dieses inquisitorische Vorgehen zeigt recht deutlich, dass der Darwinismus in der Tat eher ein religiöses (oder quasireligiöses) Dogma ist, als ein wissenschaftliches Denkmodell.
Tatsache ist: Niemand weiß zur Zeit wirklich, wie und warum die Evolution ablief.
“The mechanism of evolution is not known”, schrieb der schwedische Genetiker Lima-de-Faria. Und kein Wissenschaftler, der ehrlich ist, wird heute eine andere Antwort geben.
Wir müssen jetzt neue Denkmodelle erarbeiten: Denkmodelle, die davon ausgehen, dass nicht Kampf, sondern Kooperation - für deren Wirken es inzwischen eine Unmenge an Material aus der Naturbeobachtung gibt - das wichtigste Element der Evolution ist. Die ferner davon ausgehen, dass nicht Fortpflanzungsmaximierung, sondern situationsbezogene Selbstbegrenzung - auch dafür gibt es inzwischen eine Fülle von Beweismaterial - das normale und übliche Verfahren in der Natur ist. Und die schließlich eine ganzheitliche Sicht einnehmen, die auch Elemente wie Information, Kommunikation und Vernetzung berücksichtigt, die beim Zusammenleben der Lebewesen in der Natur eine ganz wesentliche Rolle spielen.
Die ursprüngliche Darwinsche Auffassung steht im Widerspruch zur Logik und den beobachtbaren Tatsachen, und an sie “glaubt heute sowieso kein ernsthafter Biologe mehr” (Zitat aus dem Brief eines Biologen). Die heute gängige neodarwinistische Auffassung ist eine völlig verwässerte Sammlung von Allgemeinplätzen und Binsenweisheiten, eine Mogelpackung, auf der zwar noch Darwin draufsteht, aber so gut wie gar kein Darwin mehr drin ist. Mit ihren Zauberworten “Mutation” und “Selektion” erklärt sie alles - und damit nichts.
Ein paar zufällige Fehler beim Kopieren von Erbinformation, und Hokuspokus Schwuppdiwupp - die Würmer sind Fische geworden. Noch ein paar zufällige Kopierfehler - Hokuspokus Schwuppdiwupp: die Fische haben Beine bekommen und wandern übers Land. Hokuspokus Schwuppdiwupp - die Beine sind verschwunden und es entsteht eine Schlange. Aus klein wird groß, aus groß wird klein, aus langsam schnell, aus schnell langsam, aus ungiftig giftig, aus Beinen Flossen, aus Flossen Beine - Hokuspokus, Schwuppdiwupp.
Und weil sie alle einen Überlebens- oder Selektionsvorteil bieten, auch wenn sie das genaue Gegenteil darstellen, bleiben diese Merkmale erhalten. Und über allem schwebt seine Majestät der Zufall, der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden, der große Erfinder der Photosynthese und der Lungenatmung, der Mücken und der Elefanten, der Saurier und der Hühnerflöhe.
Wer so argumentiert, betreibt Naturwissenschaft auf Kindergartenniveau. Ist das sinnvoll? Sollten wir uns damit zufrieden geben? Ich finde: nein. Zumal all die vielen arbeitslosen Biologinnen und Biologen hier auf Jahrzehnte hinaus eine sinnvolle Beschäftigung finden können: indem sie nämlich nach den tatsächlichen Grundlagen und Prinzipien der Evolution suchen.
Zurück zum Inhalt
Zurück zur Buch-Seite
© Reinhard Eichelbeck
Seltsame Dinge geschehen - Dinge, die vor 2 bis 3 Jahrzehnten noch ganz unglaublich und undenkbar gewesen wären. Ernsthafte Naturwissenschaftler reden öffentlich davon, dass der Geist die Materie beherrsche, oder dass das Bewusstsein unser Gehirn forme, und nicht das Gehirn unser Bewusstsein.
Ein Bundesforschungsminister empfiehlt den Ärzten, sich mehr um Naturheilverfahren zu kümmern und stellt ein nicht ganz unerheblich Summe für die Erforschung von Rutenphänomenen zur Verfügung.
Quantenphysiker zitieren Buddha und Laotse, Schulmediziner verschreiben mit einem Mal keine Antibiotika mehr, sondern Kräutertees und legen Hand auf, statt zum Skalpell zu greifen.
André Heller singt: “Die wahren Abenteuer sind im Kopf...”, und zu hunderten wandern Menschen in Wochenendworkshops und lernen, sich in andere Körper und andere Zeiten zu versetzen.
Kurt H. Biedenkopf schreibt im Prolog zu seinem Buch Die neue Sicht der Dinge: “Wer eine neue Ordnung denken will, muss den Mut haben, aus der alten Ordnung herauszutreten.” Bislang sorgsam gehegte Weltbilder geraten ins Wanken, von Neubesinnung ist die Rede, vom Paradigmenwechsel, vom Umbruch und vor allem vom “New Age” - vom neuen Zeitalter, vom “Zeitalter des Wassermanns”.
Ein Schlagwort, das immer wieder und immer häufiger gebraucht wird - Grund genug, hier einmal nach seiner Bedeutung zu fragen und zu schauen, was sich eigentlich hinter diesem seltsamen Begriff verbirgt.
Der Name “Wassermannzeitalter” stammt aus einem Denkmodell, das sich auf astrologische Grundsätze stützt und “Lehre von den Weltzeitaltern” genannt wird. Es geht davon aus, dass es historische Rhythmen und Abläufe gibt, die mit kosmischen Abläufen und Rhythmen zusammenhängen, von kosmischen Kräften geprägt und beeinflusst werden. Die Einteilung dieser Abläufe richtet sich der Bewegung der Erdachse und ihrer Stellung in Bezug auf den “Tierkreis”.
Wenn man die Ebene der Bahn, auf der die Erde sich um die Sonne bewegt, in den Kosmos hinausprojiziert, trifft sie auf eine Reihe von Fixsternmustern, die man in ferner Vergangenheit mit bestimmten Namen versehen hat - Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, usw.
Zu verschiedenen Jahreszeiten sieht man von der Erde aus die Sonne vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Sternbilder, die zusammen den sogenannten “Tierkreis” bilden, der sich wie ein Band um die von uns aus sichtbare “Himmelskugel” legt.
Im 2. Jahrhundert vor Christus wurde der “Tierkreis” in 12 gleiche Abschnitte zu je 30° eingeteilt, die nach den entsprechenden Sternbildern benannt sind und in gleicher Weise auch heute noch von der Astrologie benutzt werden.
Die Erdachse steht nicht ruhig - sie pendelt ein wenig und beschreibt dabei eine annähernd kreisförmige Bewegung. Entsprechend dieser Bewegung verschiebt sich der sogenannte “Frühlingspunkt”, der den Tag im Frühling bezeichnet, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Der Frühlingspunkt wandert in etwa 25200 Jahren einmal durch den Tierkreis und hält sich dabei jeweils etwa 2100 Jahre in einem Tierkreiszeichen auf. Dieser Zeitabschnitt, der als “kleines Weltjahr” bezeichnet wird, soll in seiner Grundstimmung durch das betreffende Tierkreiszeichen geprägt sein.
Nach Ansicht des Autors Alfons Rosenberg dauerte beispielsweise das “Widder-Weltjahr” von 2250 bis 150 vor Christus, das “Fische-Weltjahr” von 150 vor bis 1950 nach Christus, und von 1950 bis 4050 nach Christus wird das “Wassermann-Weltjahr” dauern, das “Wassermann-Zeitalter”, the “Age of Aquarius”.
Der österreichische Philosoph Arnold Graf Keyserling legte den Beginn des “Wassermann-Zeitalters” auf das Jahr 1962, andere Autoren erwarten ihn erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts.
Da keine Einigkeit darüber herrscht, wo genau die Sternbilder anfangen und enden, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, wann der Frühlingspunkt tatsächlich in den Wassermann wandert. Jedenfalls stehen wir aber, wenn man diesem Denkmodell folgen will, jetzt in einer Phase des Übergangs, und vielleicht ist die allgemeine gesellschaftliche und kulturelle Unruhe tatsächlich das Symptom der “Geburtswehen” eines neuen Zeitalters, eines “New Age”.
Der Frühlingspunkt gilt auch als ,,Aszendent” des Welthoroskops, von dem aus die 12 sogenannten Häuser oder Felder bestimmt werden, die in der Astrologie verschiedene Lebensbereiche bezeichnen, in denen sich die “Charakterzüge” der Tierkreiszeichen oder Planeten praktisch umsetzen.
Das 1. Feld bezeichnet beispielsweise: Grundcharakter, Selbstverständnis und Selbstäußerung, Persönlichkeit, sowie Art und Weise des Umgangs mit Dingen und Personen. Im Horoskop des “Wassermannzeitalters” verbindet sich dies mit dem Prinzip des Wassermannzeichens: Wandlung, Neuerung, Reform, Menschenfreundlichkeit, Unabhängigkeit, Originalität, Intuition, Beweglichkeit, Geistige Kommunikation, Scharfsinnigkeit, Wissen und Freiheitsdrang. Es ist aber auch schwärmerisch, unberechenbar, flüchtig, revolutionär, eigenwillig bis exzentrisch, ideologisch und hemmungslos.
Die Ambivalenz und Vielschichtigkeit des Wassermannsymbols spiegelt sich auch in der “New-Age-Szene” wieder. Vom menschenfreundlichen Reformer über den abgehobenen exzentrischen Schwärmer bis zum Scharlatan, der seine Intuition kaltblütig ausnutzt, um sich auf Kosten seiner Mitmenschen zu bereichern, ist dort alles mögliche vertreten.
Dem Wassermann-Prinzip wird auch eine gewisse “Androgynität” zugesprochen, das heißt: die klaren Geschlechtsunterschiede sind verwischt, im Sinne einer “männlichen Weiblichkeit” oder “weiblichen Männlichkeit”.
Sollte es da nur ein Zufall sein, dass die französische Philosophin Elisabeth Badinter 1987 mit einem Buch Furore machte, das den beziehungsreichen Titel trägt: “Ich bin du - die neue Beziehung zwischen Mann und Frau, oder: die androgyne Revolution?”
In einem Gespräch mit der Journalistin Susanne von Paczensky (Cosmopolitan 10/87) sagte Elisabeth Badinter unter anderem: “Männer und Frauen werden sich immer ähnlicher. Die alten Geschlechtsunterschiede sind dabei zu verschwinden. Also verschwindet auch die bisherige Form des Liebespaares, die immer zwei unterschiedliche Rollen erforderte: das war der kühne Eroberer und seine zarte Beute, der Jäger und das scheue Reh. Die wahre Liebe wird in Zukunft auf Eintracht und Nähe, auf einer eher brüderlichen Gemeinsamkeit, einer eher mütterlichen Zärtlichkeit zwischen den Geschlechtern beruhen...”
Ich glaube nicht, dass man Elisabeth Badinter dem “NewAge”-Spektrum zuordnen kann - aber von ihren Äußerungen könnte man durchaus sagen: typisch Wassermann!
Das 2. Feld im Horoskop bezieht sich traditionsgemäß auf materiellen Besitz und den Erwerb von Gütern. Im vergangenen “Fische-Weltalter” wurde es vom aggressiven und zupackenden Widder-Prinzip geprägt: man nimmt sich, was man braucht, und nimmt es anderen weg - wenn nötig, mit Gewalt.
Im “Wassermann-Weltalter” wird das 2. Feld vom auflösenden, entsagenden, friedfertigen und mitfühlenden Fische-Prinzip bestimmt: materieller Besitz wird also weniger wichtig werden, wird abnehmen und vielleicht streckenweise ganz verschwinden. Andere Dinge jedenfalls werden dem Besitzen vorgezogen werden: man kauft sein Auto nicht mehr, sondern least es, und investiert statt dessen sein Geld in eine Bildungsreise oder in neue Software für den Heimcomputer.
Denn die pionierhafte, aggressive Dynamik des Widder-Prinzips bestimmt nun das 3. Feld, das für Information, Kommunikation, Lernen, für kleine Reisen und für die Familie steht.
Und in der Tat hat sich gerade in diesem Feld in der jüngeren Vergangenheit eine Dynamik entwickelt, wie in kaum einem anderen Bereich: Fernmeldesatelliten, Breitbandverkabelung, weltweite Computernetze, Hacker und immer neue Privatradios - eine Informationsflut auf allen Ebenen schwappt über uns hinweg.
Dass die traditionelle Familie an Bedeutung verliert, zeichnet sich ebenfalls bereits ab: die Kinder verlassen früh das Haus, finden sich zu “Wahlfamilien”, zu Gruppen und Wohngemeinschaften zusammen, die eine religiös-philosophische Grundlage (Schützeprinzip in Feld 11), und der Wunsch nach Ausgleich und Harmonie (Waage in Feld 9) verbindet.
Das 4. Feld bezeichnet unter anderem Heim, Kindheit und Zuhause, den inneren “Wurzelgrund” des Menschen, Seele und Unterbewusstsein.
In Verbindung mit dem konservativen, bodenständig-schwerfälligen, naturverbundenen, auf Beständigkeit, Sicherung und schöne Umgebung bedachten Stierprinzip zeichnen sich hier Trends ab, die z.B. auf schöne Ausgestaltung der Wohnung abzielen, unter Verwendung natürlicher Werkstoffe, naturbetonte Bauweise der Häuser (Grasdach und Gewächshaus), den Wunsch, sich in der Natur zu erholen (der Hang zu Haustieren, “Hauspflanzen” und zur Datscha), sich durch die Natur zu regenerieren, und auch dadurch, dass man “in sich selbst ruht”, wobei Techniken wie Yoga, Tai Chi oder Meditation zur Hilfe genommen werden. Je hektischer, unberechenbarer, wassermännisch-wechselhafter das äußere Leben sich gestaltet, um so stärker werden wohl, als Kompensation, sich derartige Trends ausbilden.
Das 4. Feld bezeichnet auch jenen Bereich, aus dem wir unsere innere Sicherheit beziehen. Im “Fische-Weltalter” war es vom Zwillinge-Prinzip geprägt - man suchte Sicherheit im Denken, in der intellektuellen Ordnung der Dinge, im Denkmodell als Orientierungshilfe - das aber zwillingsgemäß, eher oberflächlich, als tiefgründig hinterfragend war.
Man wollte nicht bis zum Grund der Wahrheit vorstoßen - es genügte, das Gefühl zu haben, man wisse nun, wo links und rechts, wo oben und unten ist, und der globale oder kosmische Zusammenhang der Dinge sei damit erklärt. Widersprüche im Denkmodell wurden verdrängt, verleugnet oder beiseite geschoben, Kritiker nicht ernst genommen, oder vernichtet. Die christliche ebenso wie die atheistische Naturwissenschaft und Philosophie lieferten dafür reichlich Beispiele.
Hinzu kommt hier noch, dass das 9. Feld, das als zuständig gilt für Religion und Philosophie, mit dem Skorpion-Prinzip besetzt war, dem man unter anderem Selbsterhaltungstendenzen, Triebhaftigkeit und eifersüchtige Verteidigung seiner - materiellen wie ideellen - Besitztümer zuschreibt. Man will sich seine Dogmen nicht nehmen lassen - wer es trotzdem versucht, wird weggebissen.
Das 5. Feld bezieht sich auf die schöpferische Selbstdarstellung, auf Kinder (geistige & leibliche), auf Erotik und Sexualität, auf Vergnügungen und Spiele.
Im Horoskop des “Wassermann-Weltjahres” tritt hierzu das Prinzip der Zwillinge: intellektuell, beweglich, neugierig, skeptisch, vielseitig bis hin zu Zerstreutheit, Oberflächlichkeit und Zerrissenheit.
Es zeichnet sich also ab, dass z.B. Kunst und Sexualität intellektueller und oberflächlicher werden, der Trend zu Ex&Hopp-Kultur und Ex&Hopp-Erotik wird zunehmen, die großen Gefühle und die großen Dramen verschwinden, Bindungen werden schnell geschlossen und schnell gelöst, immer neue, rasch veraltende Unterhaltungsformen und Spiele werden kommen und gehen.
Romeo und Julia oder Tristan und Isolde, nebst der dazugehörigen Gestaltung in Oper und Schauspiel, sind Fossilien einer fernen Vergangenheit - dem Menschen des “Wassermann-Zeitalters” unbegreiflich, vielleicht allenfalls noch im Kulturmuseum akzeptiert, aber nicht mehr in der “Hier&Jetzt”-Realität. In die Tiefe geht man nicht mehr in der Zweierbeziehung, sondern in der Meditation, in der Begegnung mit sich selbst (Stierprinzip im 4. Feld).
Allerdings wird es, wie es sie immer gab, auch in Zukunft Menschen geben, die gegen den Strom des Zeitgeists schwimmen, die anders sind und ihr Anderssein auch leben wollen.
Von welcher Art diese Menschen sein werden, darauf weist das 12. Feld hin - das Illegalität, Verborgenheit, Gefangenschaft, Einschränkungen, aber auch geheimes Wirken, den Weg nach Innen, den Dienst am Nächsten und Selbstaufopferung repräsentiert.
Während der “Fischezeit” waren es die “Wassermänner”, die verfolgt und verketzert wurden - die Reformer und Revolutionäre jeglicher Couleur, die Vorausdenker und Menschenfreunde, die Unabhängigkeits- und Freiheitsfanatiker, die Exzentriker und Rationalisten.
Jetzt, ins 1. Feld vorgerückt, haben die “Wassermänner” Oberwasser, und die “Steinböcke” sind ins Abseits gerutscht - und mit ihnen Prinzipien wie z.B. Gewissenhaftigkeit, Sparsamkeit, Festigkeit, Ungeselligkeit, Ehrgeiz oder Zuverlässigkeit. Auch das beharrliche bis starre Festhalten an überlieferten Gesetzen oder Regeln wird nicht mehr zu den gesellschaftlich gepflegten und geförderten Verhaltensweisen gehören.
Das 6. Feld, das für die tägliche Arbeit, für Gesundheit und Krankheit steht, wandert vom Löwen in den Krebs. Das heißt: die großen Bosse verschwinden ebenso, wie die “Halbgötter in Weiß” - statt dessen erscheinen die phantasievoll-intuitiven Manager, und die mütterlich-gefühlvollen Ärzte, die Medizin bezieht sich mehr auf Seele und Gemüt, sanfte und liebevolle Behandlungsweisen treten in den Vordergrund.
Wünschenswert wäre dies allemal - auch ohne den Bezug zum “Wassermannzeitalter”.
Der Krebs, der neben Gefühl, Empfänglichkeit und Mütterlichkeit auch für Zurückgezogenheit und Häuslichkeit steht, weist in Verbindung mit Feld 6 auch noch auf zwei andere Aspekte hin: einerseits kann die tägliche Arbeit in Zukunft - Computer und neue Kommunikationstechnologien machen's möglich - zu Hause erledigt werden, andererseits kann der Betrieb - in Japan ist dies bereits deutlicher sichtbar, als bei uns - zum “Heim” werden, zur “großen Mutter”, in deren Schoß man sich geborgen fühlt.
Ein Regulativ vielleicht zur zwillingshaft-oberflächlichen oder wechselhaft-wassermännischen Tendenz der Felder 5 und 1.
Im 7. Feld, dem Feld der Beziehung, der Partnerschaft und der Vorbilder finden sich die Löwen wieder, die stolzen, strahlenden Idole, sonnenhaft selbstverwirklicht und in ihrem geistigen Persönlichkeitszentrum ruhend, werden sie bewundert, trotz gelegentlicher Überheblichkeit und Eitelkeit - vielleicht auch deshalb, weil sie so selten geworden sind.
Die Jungfrau-Besetzung des 7. Feldes im “Fische-Zeitalter” fand sich im Ideal der Jungfräulichkeit wieder, in der Ehe als nüchterne Zweck- und Zugewinnsgemeinschaft, wo vom Partner Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit und Treue erwartet wurde - nicht aber Unternehmungsgeist und Gestaltungsdrang, wie jetzt im Löwen, der andere Maßstäbe setzt. Offener und freier wird die Partnerschaft, Hilfe zur Selbstverwirklichung und Selbstgestaltung soll sie leisten.
Als Beispiel könnte man vielleicht die oben zitierte Madame Badinter anführen. Sie ist nicht nur Philosophieprofessorin, sondern auch Hausfrau und Mutter - und Monsieur Badinter, ihr Gatte, machte sich als französischer Justizminister durch die Abschaffung der Guillotine einen Namen.
Allerdings steht der Löwe in Opposition zum Wassermann, und aus dieser Konstellation kann man einige Spannungen und Auseinandersetzungen ableiten.
Die wassermännische Forderung nach “Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit” und das löwenhafte Bedürfnis nach Selbstvergötterung werden sich gelegentlich wohl recht kräftig aneinander reiben. Und es wird nicht immer nur heiße Luft dabei herauskommen - der Löwe ist dem Feuer, und der Wassermann dem Luftelement zugeordnet - sondern auch brennende Häuser oder gar Landschaften.
Das 8. Feld - gemeinsamer Besitz, Tod, höhere Energien, Okkultismus - wird von der Jungfrau bestimmt, die logisch ordnend, nüchtern und gründlich die Fakten prüft und sich ihr Urteil bildet.
Das Magisch-Mystische wird seines mystisch-magischen Mäntelchens entkleidet, untersucht, seziert und in seine Bestandteile zerlegt. Was nützlich und brauchbar ist, wird akzeptiert und verwendet, der Rest verschwindet in der Versenkung.
Während die Waage sich zur “Fischezeit” damit begnügte, die Toten in netter Form unter die Erde zu bringen, mit ein bisschen Geschwatz und Leichenschmaus, geht die Jungfrau nun forschend zu Werke und seziert die Leichen - auch wenn sie noch nicht ganz tot sind.
Ärzte untersuchen die Erfahrungen und Erlebnisse von Patienten, die klinisch tot waren und wiederbelebt wurden. Eine neue Wissenschaft - die Thanatologie - entsteht, und Sterbeforscher wie Elisabeth Kübler-Ross reisen umher, um “Sterbeseminare” zu veranstalten.
Fragen der “Sterbehilfe” werden öffentlich diskutiert, und verschiedene Fälle von “Sterbehilfe” haben in der jüngeren Vergangenheit schon für Schlagzeilen gesorgt.
Ins 9. Feld - zuständig für lange Reisen, fremde Länder und Kulturen, Gesetze, Philosophie und Religion - rückt nun die Waage, das ausgleichende und aufgeschlossene, Harmonie erstrebende Prinzip.
Die Aufgeschlossenheit für fremde Länder und Kulturen führt beinahe zwangsläufig zu einer Vermehrung der “langen Reisen”. Die Touristik gehört zu den großen Wachstumsbranchen unserer Zeit, und es werden weitere Steigerungen für die Zukunft erwartet.
Der Bereich der Gesetze ist ebenfalls in der Waage gut plaziert - nicht umsonst ist sie ja seit alters ein wichtiges Requisit der personifizierten Gerechtigkeit. Man kann also annehmen, dass das Schwert (das mehr dem Skorpion entsprach) nun in den Hintergrund tritt - und milde und ausgewogene Urteile überwiegen werden.
Für die konkurrierenden Konfessionen zeichnet sich hier eine Chance ab, sich in einem gemeinsamen Ziel und in der Einsicht zu vereinigen, dass es nur ein “höchstes Wesen” geben kann, und hinter den VIELEN “persönlichen” Göttern EIN “wesentlicher” Gott stecken muss.
Als der Papst vor einigen Jahren in Assisi den Dalai Lama umarmte, war das vielleicht doch nicht nur eine schöne Geste für die Fotografen, sondern so etwas wie ein Signal. In früheren Zeiten, als noch der grimmige Skorpion das 9. Feld besetzte, hätte man bei dieser Gelegenheit um die Gesundheit des Exiltibeters fürchten müssen.
Heute aber ist es die Politik, die ihm zu schaffen macht, denn das 10. Feld - der öffentlichen Stellung, Regierung und Karriere zugeordnet - geht nun in den Skorpion über, der das schillernde, unergründliche, in die Tiefe dringende, leidenschaftlich-triebhafte, eifersüchtige und nach Macht strebende Prinzip vertritt.
Die Inquisitoren wandern aus der Religion in die Politik. Die Besetzung Tibets durch die Chinesen Anfang der 50er Jahre, die Verdrängung der politisch-religiösen Ordnung durch das anmaßende, kollektivistische Machtprinzip (Skorpion/Pluto im 10. Feld), illustriert recht anschaulich den Übergang vom Fische- zum Wassermannzeitalter und stützt, nebenbei, die Zeiteinteilung Alfons Rosenbergs.
Andere und etwas aktuellere Beispiele, die für die Verbindung Skorpion / 10. Feld typisch sind: die Barschel/PfeifferAffäre, Nixons “Watergate” und Reagans “Irangate”. Ferner die zahlreichen dubiosen “Amigo”- und Korruptionsaffären hierzulande, sowie Folter und politischer Mord, die in vielen Ländern heute an der Tagesordnung sind.
Wenn die Annahmen des “Wassermann-Horoskops” zutreffen, wird derartiges noch öfter zu erleben sein - vielleicht sogar zur Regel werden.
Die Verbindung von Religion und Politik im “Fische-Zeitalter”, die das Gottesgnadentum der Königsherrschaft ebenso widerspiegelte, wie der weltliche Besitzdrang der Kirche, und die konfessionelle Einflussnahme auf politische Entscheidungen, wird im “Wassermann-Zeitalter” aufgebrochen.
Dem religiös-philosophischen Prinzip der Verinnerlichung - repräsentiert vom Schützen, der andererseits aber auch für Tatkraft und Begeisterung steht - finden wir nun das 11. Feld zugeordnet: das Feld der Gruppenarbeit, der Vereine und Verbände.
Kollektive geistige Arbeit, Gedankenaustausch und gemeinsame Ziele werden demzufolge eine philosophisch-religiöse Prägung bekommen und eine neue expansive Dimension erreichen.
Offen und unorthodox werden diese Gruppen sein, von jovialer Güte und Großzügigkeit bestrahlt - nicht mehr saturnisch-steinbockhaft verschlossen, reduziert und spröde wie die Ritter- und Mönchsorden, die geheimen Bruderschaften der “Fische-Zeit” - sondern netzwerkhaft und nichthierarchisch, ohne die fatale Leib- und Frauenfeindlichkeit vergangener Zeiten, Menschen aus allen Schichten zugänglich. Hier werden sich die Mitglieder einer “Aquarian Conspiracy” treffen, Schockwellenreiter, Mega-Byte-Anarchisten, Öko-Freaks und verinnerlichte Bewusstseinserweiterer, um gemeinsam aktiv zu werden im Zeichen einer neuen Spiritualität, die mit der “Oldtime-religion” etwa soviel zu tun hat, wie die Rumpler-Taube mit einer Concorde.
Man kann im Zeichen des Wassermanns mit einem totalen, weitgehend kreativen Durcheinander rechnen - und sicherlich auch mit dem einen oder anderen dauerhaften und konstruktiven Ansatz. Und all die spirituellen Turbulenzen gehören nicht nur zu den Begleiterscheinungen der Übergangszeit, sondern zum Wesen des Wassermanns: was heute als außergewöhnlich und übersinnlich gilt, wird in Zukunft das ganz Normale sein.
Die Beschreibung der “Wassermann-Trends” ließe sich noch weiter ausführen, viele Beispiele wären noch beizutragen - wir wollen es hiermit aber erst einmal bewenden lassen.
Wer sich weiter damit beschäftigen möchte, dem sei Alfons Rosenbergs “Durchbruch zur Zukunft” empfohlen, oder mein - allerdings vergriffenes - Buch “Wunder - Wende - Wassermann”. Und wer Spaß daran hat, mag selbst nach weiteren Übereinstimmungen Ausschau halten.
Es darf natürlich, zum guten Schluss, die “Warnung des Gesundheitsministeriums” nicht fehlen: all diese Zuordnungen sind mehr oder weniger spekulative Konstrukte. Ob sie eine Beziehung zur kosmischen Realität haben - oder ob wir diese Beziehung nur hineininterpretieren, muss dahingestellt bleiben.
Aber nichtsdestoweniger machen solche Gedankenspielereien Spaß - und immerhin lässt sich das, was sich derzeit so abspielt oder für die Zukunft abzeichnet, ganz anschaulich und zutreffend in einem solchen “Horoskop des Wassermannzeitalters” unterbringen.
Auf alle Fälle aber handelt es sich hier nicht um Zwänge oder unabwendbares Schicksal - sondern allenfalls um Anregungen und Möglichkeiten. Was wir daraus machen, bleibt immer unsere eigene Entscheidung.
Die Gestirne haben nur dann Macht über uns, wenn wir dies zulassen - oder, wie Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, einer der Stammväter des älteren, wie auch des neueren Okkultismus, es ausdrückte: “Nos habitat - non tartara sed nec sidera coeli - spiritus in nobis, qui viget, illa facit - In uns wohnt der Geist, der die Dinge bewirkt, nicht in der Unterwelt oder in den Gestirnen des Himmels...”
Jeder Mensch ist ein einmaliges und unverwechselbares Individuum, das seinen eigenen Weg gehen kann und gehen sollte - mit dem Strom der Zeit, oder gegen an, oder ganz abseits aller Strömungen - wie auch immer.
Der Weg ist das Ziel, und das Ziel ist das Ziel - und ob wir es durch den Bauchnabel erreichen, oder durch die Mitte der Stirn, oder mit dem Kopf durch die Wand, ist zweitrangig, denn - und darin sind sich die großen Weisheitslehrer einig - im Grunde genommen sind wir schon da.
Wir müssen nur aufwachen, um dies zu erkennen.
Zurück zum Inhalt
Von den erstaunlichen Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins.
© Reinhard Eichelbeck
(erschien Anfang 2005 als Zweiteiler im BIO-Magazin)
Janet Salisz war eine ganz gewöhnliche amerikanische Hausfrau aus Michigan, einem kleinen Ort im Norden der USA. Dass sie eines Tages berühmt werden und die “Hauptrolle” in einem aufsehenerregenden medizinischen Film spielen würde, hatte sie sich nicht träumen lassen.
Gegen Ende ihrer Schwangerschaft stellt der Gynäkologe fest, dass das Kind, das sie erwartete, nur durch einen Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden konnte. Da sie aber gegen alle bekannten Betäubungsmittel allergisch war, gab es nach Ansicht ihres Arztes nur noch eine Möglichkeit, ihr die Schmerzen zu ersparen: indem man sie vor der Operation hypnotisierte. Das Verfahren war ungewöhnlich, und deshalb ließen die beteiligten Ärzte es filmen.
Ihr Hausarzt wusste, dass Janet Salisz sich gerne durch Klavierspielen und Singen entspannte. Während der Hypnoseeinleitung zur Vorbereitung der Operation gab er ihr daher die Anweisung, sie solle sich vorstellen, dass sie Klavier spielt und dabei singt. Während des Singens, so suggerierte er ihr, werde sie sich immer weiter entspannen, und immer ruhiger werden. Diese Anweisungen wiederholte der Arzt später während der Operation, und so erlebte sie singend, wie ihr Kind durch Kaiserschnitt zur Welt gebracht wurde.
Das Baby, ein Junge, kam ohne Probleme zur Welt, und Janet Salisz bestätigte, dass sie während der Operation keine Schmerzen empfunden hatte. Nachdem dieser erste Versuch so erfolgreich verlaufen war, beschloss sie, noch zwei weitere Kinder in gleicher Weise zur Welt zu bringen: durch Kaiserschnittoperationen, die mit Hilfe von Hypnose durchgeführt wurden.
“Es war anders, als ich es mir vorgestellt hatte”, berichtete Janet Salisz später. “Es war weniger eine Veränderung im Bewusstsein, als vielmehr in meiner Körperempfindung. Ich hatte damit gerechnet, das Bewusstsein zu verlieren, aber statt dessen wurde mein Körper empfindungslos, und ich war nach der Entbindung so schlaff, dass ich kaum meine Arme und Beine bewegen konnte. Gleichzeitig war ich in einem Zustand der Euphorie und völlig in Einklang mit den Menschen um mich herum.”
Dieses außergewöhnliche Operationsverfahren erregte damals - es war in den 1960er Jahren - erhebliches Aufsehen. Aber es war keineswegs neu, sondern nur in Vergessenheit geraten. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der englische Arzt James Braid seine Patienten in Trance versetzt, um sie schmerzfrei operieren zu können. Da er den Eindruck hatte, dass seine Patienten dabei in einen schlafähnlichen Zustand gerieten, nannte er sein Verfahren - nach Hypnos, dem griechischen Gott des Schlafes - “Neurohypnose”: Nervenschlaf.
James Braids hatte großen Erfolg mit seinen Hypnoseoperationen - ebenso, wie sein schottischer Kollegen Esdaile, der in Indien über 300 Operationen mit dieser Methode durchführte. Dabei reduzierte er die damals übliche Sterberate von 60 auf fünf Prozent. Leider setzte sich diese wirkungsvolle und gleichzeitig nebenwirkungsfreie Methode nicht durch, denn kurz darauf entdeckte man Chloroform und Lachgas als Betäubungsmittel, die leichter anzuwenden waren.
Heute allerdings wird die Hypnose von einigen Ärzten wieder in ihrer ursprünglichen Weise bei Operationen eingesetzt - vor allem dann, wenn es sich um Patienten handelt, die gegen herkömmliche Betäubungsmittel allergisch sind, wie es zum Beispiel bei Janet Salisz der Fall war.
Seit Jahrtausenden schon ist bekannt, dass Menschen in Trance keine Schmerzen verspüren und zu außergewöhnlichen Dingen fähig sind, und bei zahlreichen religiösen Ritualen in aller Welt hat man sich dies zu nutze gemacht. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel hierfür findet sich auch heute noch in Singapore - beim “Taipusam”, einem Fest zu Ehren von Lord Subrahmanya, einem alten Kriegsgott der Hindus.
In einer Prozession, die über viele Kilometer zum Chettiar’s Tempel führt, tragen junge Männer reichgeschmückte, käfigartige Aufsätze, die bis zu 32 Kilo schwer sind - sogenannte “Kavadis”. Und sie tragen diese schweren Gestelle nicht nur, sie tanzen auch noch damit. Auf diese Weise lösen sie Gelübde ein, sie tun Buße für vergangene Sünden und erhoffen sich Vergebung für zukünftige.
Das erscheint nicht außergewöhnlich - aber wenn man genauer hinschaut, bemerkt man, dass die “Kavadis” in unzählige Stahlspitzen enden, die sich tief ins Fleisch der Träger bohren, dass einige sich außerdem Angelhaken in die Haut geschlagen haben, an denen Gewichte hängen. Da steht ein junger Mann, dessen Wangen quer von einem stricknadeldünnen Dolch durchstochen sind, umringt von anderen Männern, die einen rhythmischen Sprechgesang anstimmen - jetzt streckt er die Zunge heraus und einer der Männer durchbohrt sie mit einem zweiten Dolch. Das Gesicht des jungen Mannes zeigt einen ruhigen, entspannten Ausdruck, seine Pupillen sind nach oben gekehrt, verschwinden zur Hälfte unter dem Lidrand. Er ist, wie die anderen Kavaditräger auch, in Trance, empfindet offensichtlich keinen Schmerz, und - was noch überraschender ist - es fließt kein Blut bei dieser grausamen Prozedur.
Einige tausend Kilometer weiter östlich, in den USA, bildet Dr. Kay Thompson an der Universität von Pittsburgh Zahnärzte aus. Sie hat diese Fähigkeit, in Trance Blutungen zum Stillstand zu bringen, für die Zahnmedizin nutzbar gemacht. Einer ihrer Patienten ist Bluter, leidet an Hämophilie, einer schweren erblichen Krankheit, bei der die Blutgerinnung gestört ist. Wenn er sich verletzt, ist er immer in Gefahr zu verbluten, weil die Blutung nur sehr schwer gestillt werden kann. Als dann eine Zahnoperation unumgänglich wurde, versuchte Dr. Thompson es mit Hypnose - und hatte Erfolg: während der Operation blieb die befürchtete unstillbare Blutung aus. Und dies ist kein Einzelfall. Eine Untersuchung von Hämophiliekranken ergab, dass ohne Hypnose bei Operationen pro Patient zwischen fünf und 35 Bluttransfusionen nötig waren. Mit Hypnoseanwendung waren es nur zwei bis drei.
Fast erstaunlicher noch als die Fähigkeit, in Trance Blutungen zu stillen, erscheint aber die Tatsache, dass man in solch einem veränderten Bewusstseinszustand auch Blutungen erzeugen kann - ohne erkennbaren äußeren Anlass. In Fällen von sogenannter “Stigmatisierung” beispielsweise, wo am Körper von Menschen die blutenden Wundmale Christi aufgetreten sind. Seitdem das Phänomen zum ersten Mal bei Franz von Assisi beobachtet wurde, sind mehr als 300 Fälle dieser Art dokumentiert. Zu den bekannteren zählen die Augustinernonne Anna Katharina Emmerick, Louise Lateau, Therese Neumann aus Konnersreuth und der Franziskaner Francesco Forgione, genannt “Padre Pio”.
Ein weiteres spektakuläres Beispiel für die Fähigkeit des Geistes, in Trance körperliche Veränderungen hervorzurufen, bietet das sogenannte “Münzexperiment”, das in der Hypnoseliteratur häufig zitiert wird. Dabei wird einer hypnotisierten Person eine kalte Münze auf den Arm gelegt, mit der Suggestion, die Münze sei glühend heiß - und es bildet sich eine Brandblase.
Dr. Leon Chertok, Fachmann für psychosomatische Erkrankungen, und Autor verschiedener Bücher über Hypnose, gehört zu den Ärzten, die ein solches “Münzexperiment” durchgeführt haben. Er hatte in der medizinischen Literatur davon gelesen, aber nicht so recht daran geglaubt. Als er dann eines Tages eine Patientin fand, die sich sehr gut hypnotisieren ließ und bereit war, einen solchen Versuch mitzumachen, wagte er das Experiment.
Nachdem er sie hypnotisiert hatte, legte Dr. Chertok seiner Patientin eine kalte Münze auf den Unterarm und suggerierte ihr, die Münze sei sehr, sehr heiß. Er umrandete dann die Stelle, wo sich die Münze befand, und wo später die Brandblase erscheinen sollte. Auf seine Nachfrage antwortete die Patientin, dass sie keine Hitze spüre, sondern nur einen leichten Druck.
Trotzdem war nach etwa einer Stunde der Stelle, wo sich die Münze befand, eine leichte Rötung auf der Haut zu bemerken. Nach 2 Stunden konnte man bereits eine Veränderung der Hautoberfläche zu beobachten, und nach 3 Stunden hatte sich eine deutlich erkennbare Blase gebildet, die von einem Hautarzt untersucht und als eine typische Brandblase bezeichnet wurde.
Dr. Chertok war sehr beeindruckt - eine Erklärung für diesen Vorgang konnte er jedoch nicht geben. “Die Theorie besagt”, so meinte er, “dass eine halluzinierte, eine eingebildete Hitze, die gleiche Wirkung haben sollte, wie wirkliche Hitze. Aber in diesen Fall war es anders, denn die Patientin spürte gar keine Hitze - und trotzdem bildete sich eine Brandblase - so als ob eine Phantasie, ein Vorstellungsbild, sich direkt in der Haut ausprägen könnte. Ich denke, wir stehen hier vor einem großen Rätsel.”
Dr. Dabney Ewin, ein amerikanischer Arzt, hat indessen das genaue Gegenteil erreicht - er zeigte, dass man mit Hilfe von Hypnose die Folgen schwerer Verbrennungen schneller und besser überwinden kann.
Problematisch ist bei solchen Verbrennungen nicht nur die Verletzung der Haut durch die Hitze, sondern auch die Reaktion des Körpers darauf in Form einer Entzündung, von Schmerzen, Schwellungen und Brandblasen. Und diese Entzündungreaktion, so entdeckte Dr. Ewin, kann man mit Hilfe von Hypnose unterbinden.
Bei seinem ersten Fall hatte eine Alkoholexplosion das Gesicht des Patienten verbrannt und seine Augenbrauen abgesengt. Dr. Ewin traf ihn in der Notaufnahme, etwa eine halbe Stunde nach dem Unfall, versetzte ihn in Hypnose und suggerierte ihm Kühle und Wohlbefinden.
Normalerweise folgt auf eine solche Verbrennung innerhalb von 24 Stunden eine schwere Entzündung mit heftigen Schwellungen, und es dauert dann an die 6 Wochen, bis eine Heilung erfolgt ist.
In diesem Fall war es anders. Als Dr. Ewin ihn 31 Stunden später wieder besuchte, fühlte der Patient sich wohl, und es gab keine Anzeichen der sonst üblichen Schwellung und Entzündung. Die allmähliche Heilung verlief dann leicht und angenehm, und schon nach 14 Tagen konnte der Patient wieder zur Arbeit gehen.
Unzählige erstaunliche Heilerfolge durch Hypnose sind mittlerweile wissenschaftlich gut dokumentiert. Vor allem bei Krankheiten mit psychosomatischem Hintergrund, wie zum Beispiel Hypertonie, Magen- und Darmgeschwüre Ekzeme der Haut und Allergien, Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, Migräne, Störungen des Essverhaltens und Asthma. Hier wirkte Hypnose oft besser als die üblichen Medikamente.
Auf Betreiben der British Medical Association wurden beispielsweise in England klinische Untersuchungen mit 350 Asthmapatienten durchgeführt, von denen die eine Hälfte in herkömmlicher Weise, und die andere Hälfte mit Hypnose behandelt wurde. Bei der Hypnosegruppe betrug die Erfolgsquote etwa 69 Prozent, bei der Kontrollgruppe 42 Prozent - ein deutlicher Unterschied zu Gunsten der Hypnosebehandlung.
Es ist inzwischen klar geworden, dass man durch Hypnose einen direkten Einfluss auf das autonome Nervensystem ausüben kann, und zwar nicht nur im seelischen, sondern auch im körperlichen Bereich.
Das autonome Nervensystem - auch vegetatives Nervensystem genannt - steuert in unserem Körper die Drüsentätigkeit und den Herzrhythmus, die gesamte glatte Muskulatur, die Blutgefäße und verschiedene Hautreflexe, wie zum Beispiel Verengung oder Erweiterung der Poren. Die Wissenschaft war lange Zeit der Meinung, dass es durch unser Bewusstsein nicht beeinflusst werden könne - deshalb nannte man es auch “autonom”, das heißt: selbständig oder unabhängig. Berichte von Yogis oder Fakiren, die zum Beispiel ihren Herzschlag willkürlich verlangsamen, oder auch andere “autonome” Körpervorgänge beherrschen konnten, wurden als Legenden abgetan, oder auf Betrug und Manipulation zurückgeführt.
Inzwischen haben die Versuche von zahlreichen Wissenschaftlern gezeigt, dass das autonome Nervensystem doch nicht so “autonom” ist, wie man annahm, und dass wir lernen können, darauf einzuwirken: durch Fremd- oder Selbsthypnose, durch Biofeedback, durch Autosuggestionsübungen, Meditation und mentales Training.
Wie aber lassen sich diese verblüffenden, teilweise an Wunder grenzenden Wirkungen erklären, die der Geist oder das Bewusstsein über das Unterbewusstsein auf das autonome Nervensystem und von da aus auf den Körper ausüben kann?
Ein möglicher Schlüssel dazu liegt in einer Reihe von chemischen “Botenstoffen”, zum Beispiel Hormonen und Neurotransmittern, sowie jenen Teilen des Gehirns und des Nervensystems, von denen sie produziert und verteilt werden. Der wichtigste Bestandteil dieses Systems ist nach neueren Erkenntnissen der Hypothalamus. Er stellt das Zentrum des sogenannten Limbischen Systems dar, das unterhalb des Großhirns liegt und häufig auch als “Säugerhirn” bezeichnet wird, weil es bei den Säugetieren am höchsten entwickelt ist. Das Limbische System steuert unter anderem Körpertemperatur, Pulsfrequenz, Blutdruck und Blutzuckerspiegel. Es ist auch an der Entstehung von Gefühlen und emotional-triebhaften Reaktionen beteiligt.
Vom Limbischen System führen besonders viele Nervenbahnen zum Stirnlappen des Großhirns, der offenbar für Urteilsbildung, Planung, Entscheidungen und zielgerichtetes
Verhalten zuständig ist. Man hat festgestellt, dass Menschen nach Zerstörung oder Entfernung des Stirnlappens die Fähigkeit verloren, sich zu konzentrieren, vorauszuplanen oder sich an neue Gegebenheiten anzupassen.
Man könnte nun eine Verbindungslinie ziehen vom konzentrierten und zielgerichteten Denken des Stirnlappens zum Limbischen System und damit zum Hypothalamus, der unter anderem die wichtigste Hormondrüse des Körpers steuert: die Hypophyse. Diese wiederum steuert die übrigen Hormondrüsen des Körpers und die Informationsübertragung im Nervensystem. Mit dieser “Stirnlappen-Hyphothalamus-Hypophyse-Drüsen-Nerven-Schiene” bietet sich nun eine recht einleuchtende Erklärung für viele der bisher erwähnten körperlichen Wirkungen von Bewusstseinsprozessen an.
Das Hormon Kortisol beispielsweise fördert die Blutgerinnung, das vegetative Nervensystem beeinflusst die Zusammenziehung der Blutgefäße, und beide werden von der Hypophyse gesteuert: dies könnte eine Erklärung liefern für die Fähigkeit, Blutungen zum Stillstand zu bringen oder zu verhindern.
Das Kortison, ebenfalls ein Hormon der Nebennierenrinde und Abkömmling des Kortisols, hat eine antiallergische und entzündungshemmende Wirkung. Damit ließen sich beispielsweise die Erfolge von Dr. Ewin bei der Behandlung schwerer Verbrennungen erklären.
Das somatotrope Wachstumshormon STH wirkt indirekt auf alle Körperzellen, indem es Enzyme “einschaltet”, die für den Kohlehydrat-, Eiweiß- und Fettstoffwechsel zuständig sind. Es beeinflusst auch Wachstum, Wundheilung und Alterungsprozesse. Was die Regulierung des Stoffwechsels angeht, so könnte man hier einen Zusammenhang vermuten mit den Erfolgen von Hypnosebehandlung bei Über- oder Untergewicht.
Und schließlich ließe sich über das STH auch das erstaunliche Phänomen der “hypnotischen Brustvergrößerung” erklären, das der amerikanische Wissenschaftler R. D. Willard, der damals am Institute of Behavior and Mind Science arbeitete, in den 1970er Jahren durch einen Versuch bestätigte.
Er fand 22 freiwillige weibliche Versuchspersonen im Alter zwischen 19 und 54 Jahren, deren Brüste von einem unabhängigen Mediziner sorgfältig vermessen wurden: Höhe, Durchmesser und Umfang. In einer leichten Trance wurde den Frauen dann gesagt, sie sollten sich vorstellen, über ihre Brüste fließe warmes Wasser, die Brüste würden warm werden, und sie würden fühlen, wie ihre Brüste zu pulsieren beginnen. Außerdem erhielten sie auf Band gesprochene Instruktionen, mit deren Hilfe sie diese Routineübungen täglich wiederholen mussten.
Nach zwölf Wochen hatten 28 Prozent der Frauen die von ihnen jeweils gewünschte Brustgröße erreicht und beendeten die Übungen. Insgesamt hatten 85 Prozent der Frauen eine gewisse Vergrößerung erreicht und 46 Prozent mussten sich größere Büstenhalter kaufen. Der durchschnittliche Zuwachs betrug etwa 1,7 cm vertikal, 2,5 cm horizontal und 3,4 cm im Umfang. Einige Frauen brachten es auf fast das Doppelte dieses Zuwachses. Darüber hinaus hatten 14 dieser freiwilligen Versuchspersonen Kinder und wünschten sich eine festere Brust. Sie alle erreichten in dieser Hinsicht eine gewisse Verbesserung. Und schließlich, als besonderes Extra, hatten die Frauen, deren Brüste ungleich groß gewesen waren, am Ende gleich große Brüste.
Eine Wiederholung dieses Versuchs durch Psychologen an der Universität in Houston bestätigte Willards Ergebnis. Und bei einer Nachuntersuchung, drei Monate später, fand man, dass achtzig Prozent des Zuwachses erhalten geblieben war.
Zu dem wohl bekanntesten chemischen “Botenstoffen”, die unser Körper produziert, gehören die sogenannten endogenen Morphine, kurz Endorphine genannt. Endogen heißen sie, weil sie im Innern, im Gehirn selbst erzeugt werden, und Morphine, weil sie in ihrer molekularen Struktur dem Morphium ähneln, und auch ähnlich wirken: sie blockieren Schmerz und vermitteln Glücksgefühle. In besonders reichem Maße werden sie in Extremsituationen produziert - in Augenblicken höchster Anspannung und Gefahr, beim Sterben ebenso, wie bei der Geburt.
Janet Salisz, über deren Kaiserschnittoperationen mit Hilfe von Hypnose wir zu Anfang berichtet haben, sprach davon, dass sie sich “in einem Zustand der Euphorie befand, und völlig im Einklang war mit den Menschen um sie herum.” Dies ist ein deutlicher Hinweis auf erhöhte Endorphinproduktion.
Unser Gehirn ist sozusagen eine kleine chemische Fabrik, und es kann sich die Stoffe, die es braucht, um schmerzfrei und glücklich zu sein, selbst erzeugen - wenn es die Situation erfordert, oder wenn wir es dazu anregen. Trance ist offenbar auch ein Mittel, um dies zu erreichen, und Meditations- und Entspannungsübungen können eine ähnliche Wirkung haben.
Immer mehr körpereigene Botenstoffe sind in den vergangenen Jahren entdeckt und ihrer Wirkung erforscht worden. Neben den bereits genannten das aktivierende Adrenalin zum Beispiel, Melatonin, das den Biorhythmus steuert, Acetylcholin, das bei Lernprozessen eine Rolle spielt, Dopamin, das die Kreativität fördert, Serotonin, das beruhigend und ausgleichend wirkt, Endovalium, das entspannt und Ängste auflöst - und noch zahlreiche andere. Man weiß inzwischen, dass viele natürliche (wie Opium) oder chemische Drogen (wie Valium) nur deshalb wirken, weil ihre molekulare Struktur den körpereigenen Botenstoffen so sehr ähnelt, dass sie die gleichen Rezeptoren benutzen, und so die gleichen Wirkungen erzeugen können.
Tatsächlich wirken die “körpereigenen Drogen” oft besser, als ihre künstlichen Nachahmer. Bei einer Placebostudie mit einem handelsüblichen Antidepressivum schnitt das Placebo besser ab und entfaltete mehr antidepressive Effekte, als das chemische Seelenmittel. Als “Placebo” bezeichnet man Scheinpräparate, die dem Patienten mit der Versicherung verabreicht werden, es handle sich um ein hochwirksames Medikament. Und in den meisten Fällen stellt die versprochen Besserung sich ein - obwohl das Präparat keinerlei Wirkstoffe enthält.
Untersuchungen haben gezeigt, dass durch Placebos in etwa 40 Prozent der Fälle eine ebenso gute Schmerzlinderung erzielt wurde, wie durch Morphium. Bei einem Experiment mit Medizinstudenten in einem Londoner Krankenhaus, bekam die eine Hälfte der Gruppe blaugefärbte Placebopillen, die andere Hälfte rotgefärbte. Obwohl die Studenten vorher ausführlich über den Placebo-Effekt informiert worden waren, gaben viele von ihnen an, dass die roten Pillen stimulierend auf sie wirkten, und die blauen beruhigend.
Dass das Placebo selbst hier nicht die Ursache sein kann, ist offensichtlich - denn es enthält ja keinerlei Wirkstoffe. Es zeigt sich hier vielmehr ganz deutlich die Fähigkeit unseres Unterbewusstseins, die entsprechenden körpereigenen Wirkstoffe zu mobilisieren. Und die wirken nicht nur ebensogut oder sogar besser, sondern auch ohne schädliche Nebenwirkungen.
“Alle wichtigen Arzneidrogen, die die Medizin zur Therapie einsetzt, werden in ähnlicher (natürlich verträglicherer) Form vom menschlichen Körper selbst hergestellt”, schreibt der Arzt und Psychotherapeut Josef Zehentbauer in seinem Buch “Körpereigene Drogen”. Und weiter: “Jeder Mensch hat die Fähigkeit, seine körpereigenen Botenstoffe und seine psychische Energie auf die ihm eigene, individuelle Art zu aktivieren - dies könnte die Grundlage für eine neue, am Individuum orientierte Wissenschaft, für eine humanistische Medizin sein.” Und wir kennen inzwischen eine ganze Reihe von Mitteln, um unsere “körpereigene Hausapotheke” in Gang zu bringen.
Hypnose ist, wie die bereits zitierten Beispiele zeigen, eines davon. Aber was durch Hypnose erreicht wird - positive Beeinflussung des Körpers, Heilung von Krankheiten, Leistungssteigerung und ähnliches - ist auch durch Selbsthypnose, durch Selbstbeeinflussung oder Autosuggestion möglich. Der Psychologe Charles Baudouin meinte sogar: “Die Autosuggestion ist der Mustertyp jeder Suggestion. Zwischen Heterosuggestion (das heißt: Suggestion durch einen anderen, wie zum Beispiel bei der Hypnose) und Autosuggestion besteht kein grundsätzlicher Unterschied.”
Wir beeinflussen uns ständig selbst, durch alle möglichen Autosuggestionen - meist allerdings unwillkürlich und unbewusst und häufig leider auch in negativer Weise. Durch Befürchtungen, durch Vorurteile, durch destruktives Denken: das kann nicht gutgehen, das schaffe ich nie, das wird böse enden, undsoweiter.
Gedanken sind wirkende Kräfte, und wir können uns viele Unannehmlichkeiten und Krankheiten ersparen, wenn wir uns angewöhnen, die Möglichkeiten der Autosuggestion bewusst, gezielt und in positivem Sinne zu nutzen - verbunden mit Entspannungs- und Visualisierungsübungen können sie wahre Wunder wirken.
Dies erkannte Anfang des 20. Jahrhunderts auch der französische Philosoph und Apotheker Emil Coué. Gelegentlich baten ihn Kunden, ohne Anweisung des Arztes, für sie Medikamente anzufertigen. Da er die ärztliche Behandlung nicht stören wollte, gab er ihnen Scheinmedikamente, die keine wirksamen Substanzen enthielten. Nichtsdestoweniger trat in den meisten Fällen die erwartete Besserung ein, und Emil Coué lernte daraus, welch große Rolle der Glaube bei der Heilung von Krankheiten spielt.
“Jeder Gedanke, der unseren Geist ausschließlich beherrscht, wird für uns zur Wahrheit und drängt darauf, Wirklichkeit zu werden”, erkannte Emil Coué, und auch: “Bei einem Widerstreit zwischen Willen und Vorstellungskraft siegt immer die Vorstellungskraft.”
Aus diesen Überlegungen heraus entwickelte er eine Reihe von Suggestionsformeln, um die Glaubenskräfte des Menschen zur Entfaltung zu bringen. Zum Beispiel: “Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser.” Oder die Kurzformel für akute Beschwerden: “Das geht weg, weg, weg...”
Coués Erfolge, die weltweit Aufsehen erregten, führten bald dazu, dass eine Reihe von Coué-Vereinigungen gegründet wurden - unter anderem auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz - die sein gedankliches Erbe lebendig erhalten. Und Coués Buch “Die Selbstbemeisterung durch bewusste Autosuggestion” gehört nach wie vor zu den Klassikern auf diesem Gebiet.
Etwa zur gleichen Zeit setzte der deutsche Nervenarzt Dr. Johann Heinrich Schultz häufig Hypnose bei seiner therapeutischen Arbeit ein, und seine Patienten berichteten übereinstimmend, dass sie während der Hypnose ein Gefühl von Schwere und Wärme in Leib und Gliedern empfanden.
Dr. Schultz stellte dann die Überlegung an, ob man diesen Vorgang nicht umkehren, das heißt, durch die Vorstellung von Schwere und Wärme eine hypnotischen oder wenigstens hypnoseähnlichen Zustand erreichen könnte. Dieser Gedanke bestätigte sich, und Dr. Schultz entwickelte daraufhin eine Technik der “konzentrativen Selbstentspannung”, mit der er 1932 an die Öffentlichkeit trat. Er nannte diese Technik “Autogenes Training”.
Durch eine Reihe einfacher Befehle, die im Körper ein Gefühl von Schwere und Wärme erzeugen, wird eine tiefe Entspannung erreicht. Sie ist mit einem veränderten Bewusstseinszustand verbunden, der als leichte Trance bezeichnet werden kann. Das Unterbewusstsein ist in diesem Zustand offener als sonst und kann durch einfache, formelhafte Sätze beeinflusst werden, etwa: “Meine Kehle ist kühl und meine Brust ist warm”, zur Besserung von Husten oder Asthma.
Daneben gibt es einfache und allgemein anwendbare Formeln, die die innere Einstellung verbessern, zum Beispiel: “Ich schaffe es”, “Ich bin Problemen gewachsen”, oder ähnliches. Wenn man die Grundstufe einmal beherrscht, kann man zur sogenannten Oberstufe des Autogenen Trainings übergehen, in der meditative und kontemplative Übungen vermittelt werden. Man ruft bestimmte Farben, Landschaften oder Szenen vor das geistige Auge, stellt Fragen an das Unterbewusstsein, oder geht im Körper spazieren.
Eines der eindrucksvollsten Beispiele für die Wirksamkeit des Autogenen Trainings lieferte der deutsche Arzt Dr. Hannes Lindemann, der 1956 in 72 Tagen den Atlantik überquerte - in einem 5,20 Meter langen und 87 Zentimetern breiten Faltboot. Er hatte sich ein halbes Jahr lang intensiv mit autogenem Training auf die Fahrt vorbereitet. Dabei hatte er sich eine Reihe formelhafter Vorsätze gegeben, die er bei jeder Gelegenheit wiederholte, zum Beispiel: “Ich schaffe es”, “Nicht aufgeben” und “Kurs West”. Diese tief im Unterbewusstsein verankerten Vorsätze wirkten auch im Schlaf und weckten Dr. Lindemann in kritischen Situationen.
Er hat später in Abwandlung des Autogenen Trainings eine eigene Entspannungstechnik entwickelt, die er “Psychohygiene-Training” nannte. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Technik ist eine besondere Form des Atmens, die aus spontaner Einatmung, verlängerter Ausatmung und einer Atempause besteht. Dabei tritt nach einiger Zeit eine tiefe Beruhigung und Entspannung ein.
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Methoden der “konzentrativen Selbstentspannung” und zahlreiche Bücher darüber sind auf dem Markt. Das gemeinsame Ziel besteht darin, eine tiefe körperliche und geistige Entspannung zu erreichen, die Wege dahin sind unterschiedlich. Bei einigen - wie zum Beispiel der “Silva-Mind-Control” des amerikanischen Elektronikers und Psychologen José Silva - arbeitet man mit Zähltechniken. Mit geschlossenen Augen zählt man von einer bestimmten Ausgangszahl an langsam rückwärts, wobei man sich zusätzlich noch vorstellen kann, dass man auf einer Rolltreppe oder in einem Fahrstuhl abwärts fährt, und die Zahlen auf der Anzeigetafel immer niedriger werden.
Nach einer Weile erreicht man so einen veränderten Bewusstseinszustand, der einer leichten Trance entspricht. Gelegentlich wird hier auch der Begriff “Alpha-Zustand” gebraucht, weil das Gehirn dabei vorwiegend Alpha-Wellen, Wellen mit einer Frequenz von 7 bis 14 Hertz (Schwingungen pro Sekunde) aussendet.
Man kann diese tiefere Bewusstseinsebene auch durch die Rückkoppelung des eigenen Verhaltens mit einem Messgerät erreichen, wie beim Biofeedback, durch Suggestion von Schwere und Wärme, wie beim Autogenen Training, oder durch entspanntes Sitzen und Konzentration auf den eigenen Atem, wie es in verschiedenen Meditationstechniken gelehrt wird.
Im “Alpha-Zustand” wirken suggestive Sätze oder bildhafte Vorstellungen besonders gut auf das Unterbewusstsein ein. Wenn man sich nun beispielsweise vorstellt, dass man an einem schönen und ruhigen Platz, in einer Umgebung, die man gern hat, in der Sonne liegt, dann produziert der Körper als chemischen Entsprechung dieses geistigen Bildes Serotonin, Endorphine und endogenes Valium, und ein Gefühl von Ruhe, Gelassenheit und Wohlbefinden stellt sich ein.
Auch Krankheiten lassen sich auf diese Weise positiv beeinflussen. Der amerikanische Arzt Dr. Carl Simonton setzt Entspannungs- und Visualisierungsübungen schon seit vielen Jahren mit gutem Erfolg bei der Krebsbehandlung ein.
Wenn allerdings Beschwerden durch eine falsche Lebensweise entstanden sind, reichen Vorstellungsbilder und Suggestionen allein nicht aus - da muss man schon auch sein Verhalten ändern. Wer abnehmen will, muss weniger Nahrungsenergie zu sich nehmen, als der Körper verbraucht - wenn man das nicht tut, nützen auch die schönsten Suggestionen nichts. Allerdings können sie sehr hilfreich sein, wenn es darum geht das eigene Verhalten zu ändern, schlechte Gewohnheiten abzulegen und gute Gewohnheiten anzunehmen.
Es ist schon erstaunlich, in welchem Maße wir mit Hilfe unseres Geistes auf unseren Körper einwirken können. Der Ausdruck “mind over matter” - der Geist beherrscht die Materie - ist in diesem Zusammenhang durchaus zutreffend. Aber die Fähigkeiten unseres Geistes reichen noch weiter - auch über den Körper hinaus.
Menschen können anderen ihre Gedanken übertragen, wahrnehmen, was an entfernten Orten vor sich geht, oder sogar in die Zukunft schauen, sie können auf geistigem Wege das Wachstum von Pflanzen steigern oder Bakterien abtöten, sie können aus Gegenständen Informationen abrufen, oder Löffel und Gabeln verbiegen, ohne sie anzufassen.
Früher nannte man es Wunder, göttliche Gnade, Magie, oder - bei negativer Bewertung -Hexerei und Teufelswerk. Heute können wir sagen, dass es sich dabei um normale und natürliche Vorgänge handelt - um Fähigkeiten, die im Prinzip jeder Mensch besitzt, wenn auch, wie bei allen Talenten, nicht in gleichem Maße. Dass sie allgemein nur wenig genutzt werden, liegt wohl hauptsächlich daran, dass die meisten Menschen gar nicht wissen oder glauben können, dass sie solche Fähigkeiten haben, und dass man sie üben kann - wie Lesen, Schreiben, Klavierspielen, Radfahren oder Schwimmen.
6000 stehende Uhren begannen wieder zu ticken und etwa ebenso viele Löffel verbogen sich, als RTL im November 2004 mit seiner “Uri-Geller-Show” auf Sendung ging. Wie schon einmal vor gut 30 Jahren versetzte der nun 57jährige Israeli die Republik in Aufruhr. In der von Günther Jauch moderierten Fernsehshow verbog er Löffeln, Gabeln und Schlüssel, brachte stehengebliebene Uhren wieder in Gang und einen kaputten Föhn, erkannte eine Blume, die die Sängerin Yvonne Catterfeld hinter seinem Rücken gezeichnet hatte und demonstrierte mit dem Ex-Boxweltmeister Henry Maske die kräftigende Wirkung positiver und die schwächende Wirkung negativer Gedanken. Und was Uri Geller im Studio vorführte wiederholte sich tausendfach in deutschen Wohnzimmern: mehr als 170000 Menschen meldeten sich während und nach der Sendung per Telefon, Fax oder e-mail und berichteten schier unglaubliches: Tausende von Gabeln und Löffeln hatten sich verbogen, ebenso viele defekte Uhren liefen und kaputte Haartrockner, Elektrorasierer und DVD-Player funktionierten wieder.
Von den Parapsychologen wird das, was Uri Geller hier demonstrierte, als “Psychokinese” bezeichnet - vom griechischen “psyche”: die Seele und “kinesis”: Bewegung, Veränderung - die Veränderung oder Bewegung von Gegenständen durch geistig-seelische Kräfte.
Moderator Jauch war sichtlich erleichtert darüber, dass sein Stargast so gut in Form war. Denn Geller war ehrlich genug, vor der Sendung zu sagen: “Ich gebe nie eine Garantie, dass ein Experiment, das ich ankündige, auch gelingt. Und in einer Live-Sendung schon gar nicht.”
Bereits vor 30 Jahren, zur Zeit des ersten “Uri-Geller-Fiebers” zeigte sich, dass seine Fähigkeiten nicht immer auf Kommando abzurufen waren. In Wim Thoelkes Fernsehshow “Drei mal neun” und während einer Fernsehsendung in Zürich zeigte Uri Geller beispielsweise eine gute Leistung, und auf dem Flug nach Wien, wo er zu einer weiteren Sendung eingeladen war, verbog er mit “Gedankenkraft” alles mögliche, sogar die Namensschilder der Stewardessen. Abends bei der Sendung in Wien brachte er dann allerdings nichts zustande. Erst später in der Garderobe konnte er wieder Hellsehen und Löffelbiegen wie gewohnt.
Menschen mit übersinnlichen Kräften sind in der Geschichte immer wieder aufgetaucht. Von Moses und Buddha wurden Wundertaten berichtet, und Jesus von Nazareth konnte Gedanken lesen, schweben und sich unsichtbar machen - Dinge, die auch seinem Zeitgenossen Apollonius von Tyana zugeschrieben wurden. Zahlreiche Heilige, wie Joseph von Copertino, Teresa von Avila, Thomas von Aquin und Franz von Assisi erhoben sich der Schwerkraft zum Trotz in die Luft, oder tauchten an zwei Orten gleichzeitig auf, wie Antonius von Padua.
Einer der erstaunlichsten “Wundermänner” der Neuzeit war der Schotte Daniel Douglas Home, 1833 in Edinburgh geboren, und er war auch einer der ersten, deren Fähigkeiten von Wissenschaftlern überprüft und dokumentiert wurden, vor allem von dem renommierten Physiker und Chemiker Sir William Crookes.
Von Home werden die unglaublichsten Dinge berichtet: er hielt glühende Holzstücke in der Hand, ohne sich zu verbrennen, spielte verschiedene Melodien auf einer Ziehharmonika, die er mit einer Hand in einem Käfig hielt, erhob sich in Gesellschaft mehrerer Personen an die Zimmerdecke und brachte auch verschiedene Gegenstände zum Schweben. Zahlreiche Tische, die so schwer waren, dass eine Person allein sie nicht heben konnte, und einmal sogar eine Frau mitsamt dem Sessel, in dem sie saß. In einer Sitzung beim französischen Kaiser Louis Napoleon soll er einen Leuchter waagerecht in der Luft zum Schweben gebracht haben, wobei angeblich auch die Kerzenflammen waagerecht weiterbrannten.
Man hat Daniel Douglas Home die Anwendung von Tricks und Manipulationen unterstellt, aber nicht nachweisen können. Er ist nie als Betrüger entlarvt worden. Man hat auch von Massensuggestion und Halluzinationen gesprochen, die er hervorgerufen haben soll - aber das hieße ja nur, eine rätselhafte Fähigkeit durch eine andere, ebenso rätselhafte zu ersetzen.
Auch bei Uri Geller haben Kritiker immer wieder behauptet, dass seine spektakulären Demonstrationen durch Trick und Manipulation zu Stande kamen, aber Geller hat Besteckteile auch unter Bedingungen verbogen, die einen Betrug mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. Und wer ihm einmal dabei aus der Nähe zuschauen konnte, muss sich wohl oder übel von seinen Fähigkeiten überzeugen lassen.
Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit zu einem längeren Gespräch mit Uri Geller während eines Mittagessens in Hamburg, und anschließend, sozusagen zum Dessert, verbog er einen Löffel, den der Kellner uns brachte. Geller strich den Löffel nur leicht mit dem Zeigefinger am Stielansatz und legte ihn dann auf den Tisch - und dort liegend verbog der Löffel sich weiter bis zu einem annähernd rechten Winkel. Der Löffel verfärbte sich nicht, und er wurde auch nicht heiß, nicht einmal warm.
Ich habe Uri Geller natürlich nach einer Erklärung für dieses Phänomen gefragt, aber er konnte mir keine geben. Er sagte nur, dass er sich sehr stark konzentriere, und dem Löffel quasi den “Befehl” gäbe, sich zu biegen. Die Erfolge, so meinte er, seien unterschiedlich und hingen sowohl von seiner seelischen wie auch von seiner körperlichen Verfassung ab. Stress sei zum Beispiel ein Faktor, der seine Fähigkeiten blockieren könnte. Auch die Ernährung spielt seiner Ansicht nach eine wichtige Rolle. Er lebt vegetarisch und treibt viel Sport.
Was Uri Gellers Demonstrationen noch glaubwürdiger macht, ist die Tatsache, dass er nicht der einzige ist, der Metalle verbiegen kann, ohne Gewalt anzuwenden. Es hat inzwischen eine ganze Reihe von Versuchen und wissenschaftlichen Experimenten mit verschiedenen anderen “Metallbiegern” gegeben, die unter kontrollierten Bedingungen ähnliche Leistungen gezeigt haben. Es wurden Löffel, Gabeln und Schlüssel verbogen. Es wurden dünnere und dickere Metallstreifen verbogen. Es wurden unterschiedliche Metalle verbogen, und sie wurden mit oder ohne Anfassen verbogen. Professor John Hasted vom Birkbeck Kollege in London hat unzählige Experimente durchgeführt, bei denen Metallgegenstände auch aus der Entfernung verbogen wurden. Der französische Metallbieger Jean-Paul Girard hat unter Aufsicht von Dr. Crussard und Dr. Bouvaist Metallstäbe verbogen, die man zuvor in Glasröhren versiegelt hatte.
In den 1970er Jahren haben Professor Bender und seine Mitarbeiter zahlreiche Experimente mit einem Schweizer namens Silvio durchgeführt, der unter anderem einen Kaffeelöffel verbog, ohne ihn anzufassen. Ich habe vor Jahren einen Ausschnitt aus der Videoaufzeichnung dieses Vorgangs für die Titelsequenz meiner Sendereihe “Die Erde, der Himmel und die Dinge dazwischen” verwendet. Bei anderer Gelegenheit verbog Silvio in einer spontanen Psychokinesedemonstration einen Schweizer Franken - eine im doppelten Sinne ausgesprochen harte Währung.
Gelegentlich wird darauf hingewiesen, dass man durch bestimmte Chemikalien, zum Beispiel Quecksilberverbindungen, Metall weich oder spröde machen kann. Dies aber hinterlässt Spuren, die sich feststellen lassen, und man hat bei der Untersuchung der Metallteile nach solchen Experimenten nichts derartiges gefunden. Man fand aber zum Teil Verhärtungen des Metalls, gelegentlich auch spezifische Veränderungen, wie sie für Hochtemperaturreaktionen charakteristisch sind - aber die Metallteile werden, wie ich mich selbst überzeugen konnte, dabei nicht einmal warm. Bei einem Versuch, wo das Metall vorher mit radioaktiven Cäsium-Atomen beschossen wurde, zeigte sich nach der Verbiegung eine andere Verteilung des Cäsiums, als vorher.
Was diese Befunde zu bedeuten haben, ist noch nicht geklärt. Verändern oder bewegen Geller und andere Gabelbieger Kraft ihres Geistes die Atome im Metall? Der englische Astronom und Physiker Sir Arthur Stanley Eddington (1882 - 1944) meinte immerhin - und zwar schon lange bevor diese Experimente durchgeführt wurden: “Ich glaube, dass der Geist die Kraft hat, Atomgruppen zu beeinflussen, dass er sich sogar einmischen kann, wenn auf atomarer Ebene verschiedene Prozesse möglich sind, ja, dass sogar der Lauf der Welt nicht durch physikalische Gesetz vorherbestimmt ist, sondern geändert werden kann durch den nicht determinierten Willen der Menschen.”
Oder ist die Erklärung dieser Phänomene eher auf einer subatomaren Ebene zu suchen, auf der Ebene der Elektronen beispielsweise? Könnten die Gabelbieger die freien Elektronen im Metall dazu veranlassen, sich an einer Stelle zu sammeln und dadurch das Metall zu verformen? Wir wissen es nicht. Bewiesen ist aber inzwischen, durch eine Reihe von wissenschaftlichen Experimenten, dass man in der Tat mit Hilfe der Vorstellungskraft Elektronen beeinflussen kann.
Anfang der 1970er Jahre baute Dr. Helmut Schmidt, ein deutscher Physiker der in Amerika lebt und arbeitet, einen Zufallsgenerator, dessen Wirkungsweise auf der Abstrahlung von Elektronen beim radioaktive Zerfall von Strontium 90 beruht. Ein Geigerzähler fängt diese Elektronen auf. Der elektrische Impuls, der dabei entsteht, stoppt einen Oszillator, der zwischen zwei Zuständen hin und her schwingt, zum Beispiel links - rechts, oder an - aus. Mit diesem Oszillator kann man nun entweder Lämpchen verbinden, die abwechselnd an und aus gehen, oder zwei verschiedenfarbige Glühbirnen, von denen entweder die eine oder die andere aufleuchtet. Diese Lichteffekte werden durch die Elektronenabstrahlung gesteuert, aber der zeitliche Abstand, in dem die einzelnen Elektronen abgestrahlt werden, ist nicht vorhersehbar.
“Die Physiker sagen, dass dieser Atomzerfall rein zufällig abläuft”, erklärte Dr. Schmidt, “und ich halte es für einen interessanten Gedanken, dass dort, wo wir es mit reinem Zufall zu tun haben, unser Geist vielleicht eine kleine Lücke finden könnte, um einzudringen.”
Dr. Schmidt führte mit seinem Zufallsgenerator eine Reihe von Experimenten durch, in denen die Versuchspersonen den zufälligen Ablauf beeinflussen sollten, zum Beispiel indem sie sich vorstellten, dass eine rote Glühbirne häufiger aufleuchtet als eine Grüne. Über einen längeren Versuchszeitraum ergab sich dabei eine zweiprozentige Abweichung von der Zufallserwartung.
“Die Auswirkung erscheint gering”, meinte Dr. Schmidt, “aber wir haben die Versuche lange genug durchgeführt, um sagen zu können, dass es sich hier nicht mehr um Zufall handelt. Diese Personen hatten nicht einfach Glück. Es war ein echter, systematischer Effekt.” Und der Psychologe Dr. Hans J. Eysenck kommentierte: “Diese Abweichungen mögen unwesentlich erscheinen, über eine lange Testserie hinweg kommen wir jedoch auf eine Antizufallswahrscheinlichkeit von eins zu über einer Milliarde.”
Einer Reihe anderer Wissenschaftler gelang in den folgenden die erfolgreiche Wiederholung dieser Experimente, darunter Dr. Robert Jahn, Dekan der School of Engineering an der Princeton University, der in einer fünfzehnmonatigen Untersuchungsreihe über den Einfluss von Psychokinese auf Zufallsprozesse zu ganz ähnlichen Ergebnissen kam, wie Dr. Schmidt.
Gewisse Kritiker haben zwar behauptet, dass diese Ergebnisse auf Irrtümer, Manipulation oder Fälschung zurückzuführen seien, aber die Reputation der beteiligten Wissenschaftler gibt doch Grund zu der Annahme, dass man diese Phänomene ernst nehmen muss, auch wenn eine stichhaltige wissenschaftliche Erklärung dafür noch aussteht. Die Existenz einer Sache hängt ja schließlich nicht von ihrer wissenschaftlichen Erklärbarkeit ab. Elektromagnetische Wellen beispielsweise gab es schon lange bevor James Clerk Maxwell die Gleichungen lieferte, die sie mathematisch erklärbar machten.
Uri Geller hat in der eingangs erwähnten Fernsehshow neben der Psychokinese noch andere Beispiele seiner übersinnlichen Fähigkeiten demonstriert, nämlich Hellsehen und Telepathie oder Gedankenübertragung. Diese beiden Formen der sogenannten “Außersinnlichen Wahrnehmung” (ASW) lassen sich nicht immer genau trennen. Die Parapsychologen definieren Telepathie als Empfang von Informationen durch oder über entfernte Personen, und Hellsehen als Empfang von Informationen über Dinge und Ereignisse. Da aber Dinge und Ereignisse gewöhnlich mit Menschen in Zusammenhang stehen, kann man hier nicht ausschließen, dass es sich auch beim Hellsehen oft um irgendeine Art von Gedankenübertragung handelt.
In zahlreichen Fernsehsendungen und in vielen wissenschaftlichen Experimenten hat Uri Geller Symbole oder Gegenstände nachgezeichnet - und fast immer richtig - die andere Personen, die von ihm entfernt waren, zum Teil sogar in anderen Räumen, aufgezeichnet hatten. Bei Versuchen, die Dr. Harold Puthoff und Dr. Russell Targ am kalifornischen Stanford Research Institute (SRI) mit ihm durchführten, konnte Geller sogar Bilder richtig wiedergeben, die nicht von einem Menschen, sondern von einem Computer gezeichnet wurden. Bei anderer Gelegenheit hat er übrigens auch Computer zum Absturz gebracht, Programme gestoppt und Disketten gelöscht.
Bei seiner Live-Show mit Günther Jauch im November 2004 hat Uri Geller noch ein weiteres Experiment durchgeführt: er präsentierte dem Publikum eine Reihe von fünf einfachen Symbolen, einem Kreis, einem Kreuz, einem Quadrat, einer Welle und einem Stern. Eines dieser Symbole, das er vorher aufgezeichnet und in einem Umschlag verschlossen hatte, versuchte er nun den Zuschauern telepathisch zu übermitteln. Per Telefon sollten sie zurückmelden, welchen Eindruck sie empfangen hatten. Die Mehrheit votierte für den Stern, und als der Umschlag am Ende der Sendung geöffnet wurde, zeigte sich, dass Uri Geller tatsächliche einen Stern gezeichnet hatte.
Diese fünf Symbole sind bereits seit langem in der parapsychologischen Forschung in Gebrauch. Josef Banks Rhine, Direktor des Parapsychology Laboratory an der Duke University in North Carolina hatte in den 1930er Jahren von seinem Mitarbeiter Karl Zener ein spezielles Kartenspiel entwerfen lassen, das 25 Karten enthielt, die mit Kreis, Kreuz Welle, Quadrat und Stern bedruckt waren und nach ihrem Erfinder allgemein als “Zener-Karten” bezeichnet werden. Mit diesem Kartenspiel stellte Rhine zahlreiche Versuche an, um das Vorhandensein von “Außersinnlicher Wahrnehmung” wissenschaftlich zu beweisen.
Angeregt dazu wurde er durch die Experimente des Schriftstellers Upton Sinclair, der sich mit seinen sozialkritischen Romanen einen Namen gemacht hatte. Ende der 1920er Jahre unternahm Sinclair mit seiner Frau Mary Craig eine Reihe von Telepathieexperimenten, bei denen versucht wurde, Zeichnungen von einfachen Gegenständen über größere Entfernungen durch Gedanken zu übertragen. Da zahlreiche dieser Versuche erfolgreich waren, erregten sie entsprechendes Aufsehen, und Sinclair veröffentlichte 1930 darüber ein Buch mit dem Titel “Mental Radio” - Gedankenradio.
Rhine nahm diese Anregungen auf und ließ seine Versuchspersonen die Symbole der Zener-Karten an andere Menschen übertragen, oder sie bei verdeckt aufgelegten Karten bestimmen. Nach Tausenden von Versuchen mit Hunderten von Menschen, kam Rhine zu der Schlussfolgerung, dass es tatsächlich eine “Außersinnliche Wahrnehmung” gab, und dass sie “zu den natürlichen Eigenschaften, den natürlichen Fähigkeiten des Menschen gehört.”
Seine Kritiker waren allerdings anderer Meinung und verwiesen darauf, dass verschiedene andere Wissenschaftler damals nicht in der Lage waren, Rhines Ergebnisse zu wiederholen. Außerdem wurden die Leistungen seiner Versuchspersonen, die zu Beginn hohe Trefferzahlen aufwiesen, im Laufe der Versuche schwächer, wodurch sich ein überzeugender statistischer Beweis nur noch sehr schwer erbringen ließ.
Inzwischen haben Parapsychologen auch versucht, mit Meditation, Entspannungsübungen und sogar mit Hypnose die ASW-Leistungen zu verbessern. Und es gibt in der Tat Hinweise darauf, dass solche veränderten Bewusstseinszustände die Fähigkeit zu “Außersinnlicher Wahrnehmung” steigern. Das gilt auch für jenen Bewusstseinszustand, den wir Traum nennen.
Die Geschichte berichtet von vielen Fällen von “Außersinnlicher Wahrnehmung”, die Menschen im Traum erlebten. Der römische Philosoph und Politiker Cicero schrieb beispielsweise im 1. Jahrhundert vor Christus: “Wenn die Seele im Schlaf von ihrer engen Verbindung mit dem Körper hinweggeholt wird, dann wird die Vergangenheit lebendig, die Gegenwart genau erkannt und die Zukunft vorhergesehen. Obwohl der Körper liegt, als ob das Leben ausgelöscht wäre, ist die Seele ganz lebendig - um wieviel wahrer wird sie leben und gedeihen, wenn erst der Tod sie ganz vom Fleisch befreit.”
In Anlehnung an solche Erkenntnisse entwarfen in den 1960er Jahren Dr. Montague Ullmann und Dr. Stanley Krippner, zwei Wissenschaftler am Maimonides Medical Center in New York, eine Versuchsanordnung, mit der sie die Frage klären wollten, ob eine Gedankenübertragung im Traum möglich ist: Traumtelepathie.
Krippner und Ullmann gingen bei ihren Experimenten von der Erkenntnis aus, dass der Mensch im Verlauf einer Nacht mehrmals träumt, und das sich seine Augen während dieser Traumschlafphasen schnell hin- und herbewegen. Man spricht daher auch von der rapid-eye-movement- oder REM-Phase. Während die Versuchsperson schlief, konzentrierte sich der Experimentator auf ein Bild mit einem charakteristischen Motiv, zum Beispiel einem fliegenden Engel mit bunten Flügeln. Sobald an den Augenbewegungen festzustellen war, dass die Versuchsperson sich in einer Traumschlafphase befand, weckte man sie auf und ließ sie ihren Traum erzählen.
Das hörte sich dann beispielsweise etwa so an: “...Segel von verschiedenen Farben, wie Vögel. Und eine Frau, eine Göttin spazierte über den Ozean und in ihrer rechten Hand ließ sie einen Schmetterling los, einen grünen und rosafarbenen Schmetterling...”
Manchmal wurde auch die Befindlichkeit des “Senders” übertragen, und nicht das von ihm angeschaute Bild. “Ich kann mich kaum auf das Bild konzentrieren”, schrieb einer in seinem Protokoll, “da ich starke Magenschmerzen habe; ich denke dauernd an Magenoperation, Bluttransfusion, Viruserkrankung.” Zur gleichen Zeit träumte die Versuchsperson: “Ich bin in einem Krankenhaus und erwarte eine Magenoperation, eine Bluttransfusion wird vorbereitet, Ärzte an meinem Bett sprechen von Viruserkrankung.”
Die Erfolge mit “Traumtelepathie” ermutigten Charles Honorton vom Psychophysical Research Laboratory, eine noch bessere Versuchsanordnung zu entwerfen, um solche Ergebnisse auch im Wachzustand zu erreichen, und entwickelte dazu eine Technik, die er “Ganzfeld” nannte.
Während der “Ganzfeld”-Experimente wurden der “Empfängerperson” die Augen durch rote, mit Watte gefüllte Halbkugeln verschlossen, und außerdem Kopfhörer aufgesetzt, aus denen ein diffuses Rauschen ertönte. Dadurch sollte eine Ablenkung durch äußere Sinnesreize ausgeschlossen werden. Die “Senderperson” betrachtete gleichzeitig in einem anderen Raum ein Bild, das sie der “Empfängerperson” zu übermitteln versuchte. Anschließend musste die “Empfängerperson” sich eine Reihe verschiedener Dias anschauen und entscheiden, welche am Besten mit dem, was sie gesehen hat, übereinstimmen.
Erstaunlich waren hier vor allem die 100prozentigen Treffer: beispielsweise, wenn der “Empfänger” von Coca Cola sprach oder einem Nachtclub in Las Vegas, und das Zielobjekt tatsächlich Colaflaschen beziehungsweise einen Nachtclub in Las Vegas zeigte, oder wenn er William Blakes Gemälde “Der Alte der Tage” vor seinem geistigen Auge sah, und es sich beim Zielbild tatsächlich um dieses Kunstwerk handelte.
Inzwischen haben auch andere Wissenschaftler erfolgreiche “Ganzfeld”-Versuche durchgeführt, und Dr. William Braud von der Mind Science Foundation meinte dazu: “Die ‚Ganzfeld‘-Technik befreit den Geist von Begrenzungen. Sie vermindert die Ablenkung im Nervensystem und die Ergebnisse sind normalerweise recht erfolgreich. Ich möchte sagen, dass bei meiner eigenen Arbeit etwa 75 Prozent unserer Versuche positive Ergebnisse erbracht haben. Dies ist ein Beweis für übersinnliche Fähigkeiten.”
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch jene Fälle, wo Tiere, Pflanzen oder Mikroorganismen auf menschliche Gedanken reagieren, und wo man annehmen kann, dass es sich hier ebenfalls um eine Form von Telepathie handelt.
Der Biologe Dr. Rupert Sheldrake, der durch seine Theorie der “morphogenetischen Felder” bekannt wurde, hatte eine Nachbarin, die eine Katze hielt. Sie erzählte ihm bei Gelegenheit, dass sie immer genau wisse, wenn ihr Sohn nach Hause käme, weil die Katze sich dann neben die Eingangstür setze und miaue, bis er eingetroffen sei. “So weiß ich immer, wann ich anfangen kann, ihm Tee zu machen”, sagte sie Sheldrake.
Der Biologe begann sich für dieses Phänomen zu interessieren und solche Fälle zu sammeln. Nachdem er einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem er Haustierbesitzer, die ähnliche Erfahrungen machten, wie seine Nachbarin, bat, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, bekam er hunderte von Zuschriften. In ihnen wurde von zahllosen Hunden und Katzen berichtet, die sich an die Tür setzten, wenn ihre Besitzer im Begriff waren, nach Hause zu kommen. Die meisten Tiere reagierten bereits, wenn die betreffende Person den Gedanken fasste, heimzukehren - und nicht erst kurz bevor sie eintraf. Es liegt nahe, hier eine Art telepathischer Verbindung anzunehmen.
Auch andere Vorfälle weisen in diese Richtung. Eine Frau berichtete zum Beispiel, dass ihre Schildkröte sich immer zu ihrem Futterplatz begab, wenn sie nur daran dachte, dass es an der Zeit wäre, sie zu füttern. Oder die Fähigkeit von Haustieren, die irgendwie verlorengegangen waren, auch über große Entfernungen wieder zu ihrer Familie zurückzufinden. In den USA wurde beispielsweise die Perserkatze Sugar berühmt, die beim Umzug ihrer Besitzer von Kalifornien nach Oklahoma die Abfahrt verpasste. Sie hielt sich ein paar Tage bei Nachbarn auf, verschwand dann und tauchte ein Jahr später bei ihren alten Besitzern wieder auf, wobei sie über fünfzehnhundert Kilometer durch ihr unbekanntes Gebiet zurücklegte. Auch hier reichen die normalen sinnlichen Fähigkeiten nicht aus, um diese außerordentliche Leistung zu erklären. Und es gibt eine ganze Reihe solcher Fälle, die nicht nur von Katzen, sondern auch von Hunden und Vögeln berichtet werden.
Der “Sechste Sinn” der Tiere ist auch bei Katastrophen höchst hilfreich. Die Touristen, die am Morgen des 26. Dezember 2004 den Yala-Nationalpark im Südosten Sri Lankas besuchten, waren sehr enttäuscht, weil weit und breit keine Tiere zu sehen waren. Keine Leoparden, keine Affen, nicht einmal Wildschweine, die gewöhnlich die Abfälle der Station nach essbarem durchwühlen. Nur drei Elefanten waren zu sehen, die sich eilig landeinwärts bewegten. Als wenig später die mörderische Flutwelle den Nationalpark überschwemmte, fanden etwa 60 Menschen den Tod. Was erstaunlicherweise fehlte, nachdem das Wasser sich verzogen hatte, war eine entsprechende Anzahl von Tierkadavern. Die Tiere hatten offenbar die Katastrophe vorausgeahnt und sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Ähnliches wurde auch aus anderen Regionen berichtet.
Dass Tiere bevorstehende Erdbeben wahrnehmen können, ist seit langem bekannt. In über 500 Jahre alten chinesischen Urkunden wird berichtet, dass vor Erdbeben ungewöhnliches Tierverhalten zu beobachten sei. Anfang der 1970er Jahre hatte die chinesische Regierung deshalb die Bevölkerung aufgerufen, auf das Verhalten der Tiere zu achten und bei Besonderheiten die Behörden zu informieren. Als im Februar 1975 aus der Provinz Liaoning Tausende von seltsamen Beobachtungen berichtet wurden, von Schlangen, die aus dem Boden krochen, Pferden und Kühen, die aus ihren Ställen ausbrachen, Ratten und Mäusen, die aus ihren Löchern kamen und Katzen, die aus den Häusern verschwanden, wurde Erdbebenalarm gegeben. Zahlreiche Städte und Dörfer wurden geräumt, hunderttausende von Menschen evakuiert und im Freien untergebracht. Kurz darauf fand ein schweres Erdbeben statt, dem unzählige Gebäude, aber dank der Räumungsmaßnahmen nur sehr wenige Menschen zum Opfer fielen.
Was genau die Tiere warnt, ist noch umstritten. Etliche Wissenschaftler glauben ohnehin nicht an einen Zusammenhang zwischen Erdbeben und Tierverhalten und sprechen von Zufall, andere vermuten veränderte Luftelektrizität oder Infraschall, besonders langgezogene Schallwellen, als Auslöser. Aber eine gesicherte Erklärung, warum Tiere vor solchen Katastrophen - im Gegensatz zu Menschen - rechtzeitig und richtig reagieren, steht noch aus.
Was die Gedankenübertragung von Mensch zu Tier betrifft, so hat man zum Teil auch versucht, durch direkte Mentalsuggestionen auf Tiere einzuwirken. Der russische Psychiater und Neurologe Wladimir Bechterew (1857-1927), der zusammen mit Pawlow die Lehre vom bedingten Reflex entwickelt hat, machte solche Experimente mit Hunden, bei denen er das Tier an der Schnauze hielt und sich in Gedanken auf eine bestimmte Aufgabe konzentrierte. Er schrieb darüber unter anderem: “Die Aufgabe, die nur mir bekannt war, bestand darin, dass der Hund ein Taschentuch aus der rechten Hand von Dr. S. ziehen sollte, der etwas zurückstand. Wie gewöhnlich dauerte die Suggestion nicht mehr als eine halbe Minute. Danach stürzte sich der Hund augenblicklich auf die rechte Hand von Dr. S. und riss ihm das Taschentuch weg.”
Wäre es da nicht denkbar, dass Briefträger oder Jogger, die Angst vor Hunden haben und fürchten gebissen zu werden, dieses Schicksal oft deshalb erleiden, weil sie den Tieren ein geistiges Bild ihrer Befürchtungen übermitteln, das von diesen als Befehl oder Aufforderung missverstanden wird?
Auch die Möglichkeit, auf Mikroorganismen mental einzuwirken, ist inzwischen durch eine Reihe von Experimenten gut dokumentiert. 1995 hatte ich die Gelegenheit, mit Dr. Philipp Evrard solche Versuche zu filmen, die im “Institut für wissenschaftliche Fotografie” in Weißenstein durchgeführt wurden. Zuerst ging es darum, Bierhefe- und Kolibakterienpräparate zu vermehrtem Wachstum anzuregen. “Die Messungen ergaben eine signifikante Wachstumszunahme”, so hieß im abschließenden Forschungsbericht. Während die Wachstumsraten in der Regel zwischen 5 und 50 Prozent betragen, ergab sich hier “eine quantitative Vermehrung um das 5000fache”.
In einer weiteren Versuchsreihe sollten Legionellen, die Erreger der sogenannten “Legionärskrankheit” unschädlich gemacht werden. Auch dieses Experiment war erfolgreich: “Wie die mikroskopischen Aufnahmen dokumentieren, wurde bereits nach 28 Stunden eine deutliche Erhellung (entspricht der Neutralisierung) der Erreger festgestellt.” Und nach 50 Stunden zeigte eine Untersuchung der Erreger: “Ein Kontaminierungsrisiko für die Menschen besteht nicht mehr.”
Schließlich gibt es noch zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass man auch auf Pflanzen durch Gedanken und Gefühle einwirken kann. Der große amerikanische Pflanzenzüchter Luther Burbank beispielsweise hat eine Fülle neuer Pflanzen geschaffen, und dies zum Teil auch, so sagt man, durch geistige Beeinflussung. Eine seiner erstaunlichsten Züchtungen ist ein Kaktus, der keine Stacheln hat. Und er soll dies dadurch erreicht haben, dass er den Kaktus überzeugte, dass er seinem Garten keine Feinde zu fürchten habe. Burbank hat erstaunliche Züchtungserfolge erzielt - weiße Brombeeren, und Brombeeren ohne Dornen, unzählige neue Sorten von Obst und Blumen - aber konnte er wirklich Pflanzen durch Gedanken verändern? Er hat dies einem Journalisten gegenüber so geäußert. Und er hatte offenbar heilende Kräfte, denn zahlreiche kranke Menschen kamen zu ihm , um sich von ihm die Hände auflegen zu lassen. Einen wissenschaftlich schlüssigen Beweis für seine mentale Pflanzenschöpfung gibt es allerdings nicht.
Dass es aber möglich ist, das Wachstum von Pflanzen durch Gedanken zu beeinflussen - das ist mittlerweile bewiesen. Im Sommer 1991 hat Professor Dr. Manfred Hoffmann von der FH Weihenstephan-Triesdorf mit Hilfe des Bayerischen und des Westdeutschen Rundfunks ein großangelegten Experiment durchgeführt, bei dem es darum ging, Tomatenpflanzen durch liebevolle Gedanken zu mehr Ertrag zu veranlassen. Der Erfolg - wissenschaftlich kontrolliert - war eindrucksvoll: die geliebten Tomaten produzierten über 20% mehr Früchte, als die ungeliebte Kontrollgruppe.
Es gibt, was die Telepathie zwischen Menschen und anderen Lebewesen angeht, inzwischen genügend Experimente, die man durchaus als erfolgreich bezeichnen kann - in dem Sinne, dass nicht unbedingt Gedanken in Form von Sätzen, aber immerhin Bilder, bildhafte Eindrücke und Gefühle übertragen wurden. Und dies zum Teil mit erstaunlicher Genauigkeit. Andererseits gibt es neben den Erfolgen auch ebenso eindrucksvolle Misserfolge - und das zeigt, das wir dieses Phänomen bislang weder richtig im Griff, noch richtig begriffen haben. Die Fähigkeit der Gedankenübertragung ist auch bei überdurchschnittlich begabten Personen sehr unzuverlässig, und es ist schwer zu unterscheiden, ob ein Bild oder ein Eindruck tatsächlich auf außersinnlicher Wahrnehmung beruht, oder aber eine Phantasie, ein Wunschtraum oder eine Halluzination ist. Es besteht also vorläufig noch kein Grund, das Telefon abzumelden.
Die Übergänge zwischen Telepathie und Hellsehen, jener anderen Form der “Außersinnlichen Wahrnehmung”, verlaufen fließend. Uri Geller hat beides unzählige Male mit Erfolg demonstriert. Während der Fernsehsendung im November 2004 fand er unter einer Reihe von Schachteln exakt diejenige heraus, die das Zielobjekt enthielt: einen Ring. In den vergangenen Jahren hat er unter anderem ein stattliches Vermögen damit verdient, dass er für verschiedene Unternehmen die Orte bestimmte, an denen Bodenschätze, beispielsweise Gold oder Öl zu finden waren. Am Stanford Research Institute in Kalifornien hat Geller eine Serie von Experimenten absolviert, bei denen er einen Gegenstand lokalisieren sollte, der in einer von zehn Aluminiumdosen versteckt war. Bei zwölf Versuchen war er zwölfmal erfolgreich. In einer weiteren Versuchsreihe wurden Würfel in Schachteln verborgen, und Geller sollte herausfinden, welche Zahl des jeweiligen Würfels oben lag. Bei zwei Schachteln musste er passen, da er keinen Eindruck empfing, bei den acht übrigen nannte er die oben liegende Zahl des Würfels korrekt.
Russell Targ und Harold Puthoff haben am Stanford Research Institute in den 1970er Jahren noch weitere Versuche mit einer besonderen Form des Hellsehens durchgeführt, die sie “remote viewing” nannten - “Fernwahrnehmung”. Besonders eindrucksvoll waren die Ergebnisse bei ihrer ersten Versuchsperson, einem ehemaligen Polizeikommissar namens Pat Price. Ein typisches Experiment lief so ab, dass Targ mit Price im Laboratorium zurückblieb, während sich Puthoff mit einem Kollegen an einen unbekannten Ort begab. Zu einer vorher genau festgelegten Zeit versuchte Price, ihn zu lokalisieren. Er saß dabei in einem elektrisch abgeschirmten Käfig, der Funkkontakt unmöglich machte. Außerdem war immer ein unparteiischer Zeuge dabei.
“Sie scheinen sich hoch oben in einem Turm zu befinden”, sagte Price in einem der Experimente. “Ich sehe Rot - da sind rote Dächer, Dachziegel und ein Ziegelfußboden. Nun gehen sie durch Kolonnaden. Es scheint ein Gebäude zu sein, das alleine steht. Eine Bibliothek, ein Museum vielleicht. Könnte es der Hoover Tower auf dem Gelände der Stanford University sein?”
Die Aussage war zutreffend. Puthoff war tatsächlich auf die Spitze des Hoover Tower gestiegen. Unter ihm befanden sich die roten Dächer und die roten Ziegel, die Pat Price beschrieben hatte. Er erkannte auch richtig die Kolonnaden und die Tatsache, dass der Turm eine Bibliothek und ein Museum beherbergt. Aber hätte das nicht auch ein glücklicher Zufall sein können? Hoover Tower war einer von 60 möglichen Zielorten, deren Namen im Büro des Laboratoriumsdirektors eingeschlossen waren. Ein Computer lieferte eine Zufallszahl und der ihr entsprechende Umschlag wurde ausgewählt.
Bei einem anderen Experiment nahm der Laboratoriumsleiter die Sache selbst in die Hand. Um festzustellen, ob nicht doch ein verborgener Fehler in der Versuchsanordnung vorhanden, oder sogar Betrug im Spiel war, fuhr er gemeinsam mit Puthoff vom SRI ohne ein bestimmtes Ziel fort. Er entschied sich, nach Westen zu fahren, änderte aber nach fünf Minuten seine Meinung und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Und dann änderte er ganz spontan immer wieder seine Richtung, bis er schließlich die Fahrt an einem etwa acht Kilometer entfernten kleinen Yachthafen beendete . Als Pat Price gefragt wurde, ob er den Zielort beschreiben könne, sagte er: “Ich sehe einen Hafen, einen Yachthafen. Viele kleine Boote, Motorboote, Segelboote. Einige Segel sind aufgerollt. Ja, ein Yachthafen...”
Andere Versuchspersonen waren bei Targs und Puthoffs Experimenten ebenfalls erfolgreich, und auch andere Wissenschaftler kamen bei ihren Versuchen zu ähnlichen Ergebnissen. Kein Wunder also, dass sich auch die Geheimdienste für diese Phänomene interessierten. Russell Targ hat beispielsweise Jahre später zugegeben, dass seine Arbeit am Stanford Research Institute von der CIA finanziert wurde, und dass man auch versucht hat, auf geistigem Wege ins Innere russischer Militäranlagen einzudringen. Und Uri Geller berichtete ebenfalls, dass er für die CIA verschiedene Projekte durchgeführt hat. Unter anderem sollte er herausfinden, was sich in einzelnen Räumen der russischen Botschaft in Mexiko befand, und er sollte auch versuchen, Menschen aus der Distanz mental zu beeinflussen. Ob und wie weit er dabei erfolgreich war, hat man ihm allerdings nicht mitgeteilt.
Alles in allem müssen wir angesichts dieser Fülle von gut dokumentierten wissenschaftlichen Untersuchungen zu der Schlussfolgerung kommen, dass es Hellsehen, Telepathie und Psychokinese tatsächlich gibt, auch wenn sie vorläufig nicht schlüssig zu erklären und sicher zu kontrollieren sind. Und dass es sich ferner um natürliche Kräfte handelt, die im Prinzip jeder Mensch besitzt, wenn auch sicherlich, wie bei allen Talenten, nicht in gleichem Maße. Bleibt noch die Frage, wie wir diese Fähigkeiten sinnvoll und konstruktiv nutzen können.
Zuerst einmal sollten wir damit rechnen, dass nicht nur unsere Worte, sondern auch unsere Gedanken bei anderen Lebewesen ankommen, und dass, wenn wir schlecht von einem Menschen denken, er dies unbewusst aufnehmen und entsprechend reagieren könnte. Wir sollten keinesfalls, wenn wir einem Hund begegnen, uns im Geiste vorstellen, dass er uns anspringt und beißt. Wir sollten generell, wenn wir an Pflanzen, Tiere oder Menschen denken, dies in positiver und konstruktiver Weise tun. Besonders wichtig ist das in Bezug auf Mütter und ihre Kinder.
Wenn eine Mutter beispielsweise, während das Kind in der Schule seine Klassenarbeit schreibt, denkt: “Wahrscheinlich schreibt es wieder eine Fünf”, übermittelt sie ihrem Kind damit unter Umständen einen “Befehl”, den es um so eher befolgen wird, je mehr es gewohnt ist, Befehlen zu gehorchen. Aber auch Befürchtungen, wie: “Hoffentlich schreibt es keine Fünf”, können als Befehle wirken, weil das Unterbewusstsein Verneinungen oft nicht so recht begreift. “Mein Kind ist ruhig und sicher, und es schreibt eine gute Arbeit”, wäre zum Beispiel ein sinnvoller Gedanke. Es ist keineswegs sicher, dass solche Gedanken ankommen, aber zahlreiche Indizien sprechen dafür, und selbst die bloße Möglichkeit, dass sie es tun, spricht für eine generell positive Formulierung. Und die Energie, die wir dabei aufwenden, ist die gleiche.
Gedanken sind wirkende Kräfte - das ist keine bloße Ansicht, sondern eine Tatsache, tausendfach dokumentiert. Mit Hilfe unserer Vorstellungskraft können wir erstaunliche, ja unglaubliche Dinge erreichen. Interessant ist das vor allem, wie schon im ersten Teil dieses Artikels angesprochen, in Bezug auf unserem eigenen Körper.
Wir können Blutungen zum Stillstand bringen und entstehen lassen, wir können Schmerzen erzeugen und zum Verschwinden bringen, wir können Krankheiten hervorrufen und beseitigen - wenn wir selbst die Verantwortung dafür übernehmen und daran arbeiten. Wir können die Wirkung von Substanzen ins Gegenteil verkehren und unsere innere Hausapotheke aktivieren, die zahlreiche, den gängigen Medikamenten gleichwertige, oft sogar überlegene Stoffe zu produzieren vermag. Und wir können durch verschiedene Arten des mentalen Trainings lernen, unseren Geist gezielt, konsequent und konstruktiv einzusetzen.
Wir können das Wachstum von Tomaten fördern und das Wachstum von Bakterien hemmen. Wir können intuitiv verborgene Dinge erkennen, oder sehen, was sich an anderen Orten abspielt. Und wir können sogar Materie beeinflussen und verändern - wenn auch in vergleichsweise bescheidenem Rahmen. Wer immer wieder mit dem Auto Pannen hat, oder bei wem sich Computerabstürze häufen, sollte einmal überprüfen, inwieweit dabei möglicherweise die eigene Vorstellungskraft beteiligt ist - und sei es auch nur in Form von Befürchtungen oder negativer Einstellung.
Das gleiche gilt natürlich auch für Krankheiten, denn - wie schon Emil Coué sagte: “Eine Krankheit befürchten heißt, sie hervorrufen”. Und es gibt zahlreiche Indizien, die darauf hinweisen, dass dies auch für unser Schicksal, für unsere Zukunft gilt. Ein Bauingenieur, dem gekündigt wurde, fragt sich: warum ich, warum nicht einer von den anderen? Ja - warum? Weil er eine Kündigung befürchtete? Weil er damit rechnete, sich in Gedanken damit beschäftigte und dadurch eine Art geistiges Feld erschuf, mit dem er das Unglück anzog? Die bloße Möglichkeit, dass solche Dinge eine Rolle spielen könnten, sollte uns veranlassen immer nur konstruktiv von unserer Zukunft zu denken und zu reden. Nur das im Auge zu behalten, was wir wirklich wollen - und uns nicht mit dem zu beschäftigen, was wir nicht wollen.
Natürlich haben wir auch das Recht, arm zu sein, krank, erfolglos und unglücklich - wenn wir das wollen. Aber wollen wir das wirklich? Wir entscheiden es selbst, wir haben es in der Hand, unser Leben zu gestalten - so oder so. Wir müssen uns nur darüber klar werden, dass wir selbst verantwortlich sind - nicht nur für das, was wir tun, sondern auch für das, was uns geschieht, und bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen.
Zurück zum Inhalt
Zurück zu "Filme & Hörspiele"
Zurück zu "Bücher & Cd's"
Ein Plädoyer für die Unsterblichkeit
© Reinhard Eichelbeck
(erschienen in "BIO" 6/2003)
Etliche Jahrtausende lang hielten es unsere Vorfahren für selbstverständlich, dass in ihrem sterblichen Körper eine unsterbliche Seele wohnt, die den Tod des Körpers überlebt. Die Inder, die Ägypter, die Juden, die Griechen, die Kelten und Germanen - sie alle glaubten an die Unsterblichkeit unserer geistigen Essenz - und meist auch an eine mögliche Wiedergeburt.
Erst seit etwa 200 Jahren ist diese Vorstellung bei uns im Westen mehr und mehr bezweifelt worden, und die Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts betrachteten Seele und Bewusstsein des Menschen als eine bloße Funktion der Gehirnzellen. “Wozu von Geist reden? Unser Verhalten, unsere Gedanken, unsere Gefühle sind Ergebnisse physikalischer und chemischer Vorgänge im Gehirn”, schrieb der französische Neurobiologe Jean-Pierre Changeux 1983 in seinem Buch “Der neuronale Mensch”.
Allerdings konnten er und seine Kollegen bis heute keine annehmbare Erklärung liefern, wie die elektrische Aktivität unserer Gehirnzellen das Bewusstsein, den unterschiedlichen Charakter, die individuellen Fähigkeiten und Talente, Vorlieben und Abneigungen, Gedanken und Erinnerungen hervorbringt. Inzwischen hat sich eine Gegenbewegung angebahnt, die das Bewusstsein, oder die Seele wieder als eine eigenständige, vom Körper unabhängige Instanz betrachtet, und ihre Unsterblichkeit gilt nicht mehr nur als ein mittelalterlicher Aberglaube.
Der Modeschöpfer Paco Rabanne bevorzugt schwarze und graue Kleidung - mit der Begründung, dass er in einem früheren Leben Priester war und dabei diese Farben schätzen lernte. Die Schauspielerin Shirley MacLaine hat durch eine spezielle Form der Akupunktur ihre Erinnerungen an frühere Inkarnationen zu Tage gefördert und in Büchern und Fernsehfilmen veröffentlicht. Stars wie Richard Gere oder Tina Turner bekennen sich öffentlich zum Buddhismus, für den der Glaube an Reinkarnation selbstverständlich ist.
Es ist offensichtlich, dass das Interesse an Unsterblichkeit und Wiedergeburt ebenso wie die Untersuchungen und Veröffentlichungen darüber in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen haben und immer noch zunehmen. Und in der Tat finden sich mittlerweile eine ganze Reihe von gut dokumentierten Tatsachen, die als eine Bestätigung für die Unsterblichkeit der Seele und auch für eine mögliche Wiedergeburt gelten können. Von einem objektiven Beweis kann man hier nicht sprechen, aber immerhin von zahlreichen überzeugenden Indizien.
Indiz Nummer 1: die Kommunikation mit Toten.
Es gibt eine ganze Reihe eindrucksvoller Schilderungen von Menschen über ihre Begegnungen mit Verstorbenen, vorzugsweise nahen Verwandten. Sie wurden gehört, gesehen, manchmal auch nur gefühlt. Sie kamen um Trost zu spenden, um zu sagen, dass es ihnen gut geht, gelegentlich auch, um vor Gefahren oder falschen Entscheidungen zu warnen. Manchmal erschienen sie im Augenblick ihres Todes, zum Teil an weit entfernten Orten, manchmal nach Tagen, oder sogar erst nach Jahren.
Die Thanatologin Dr. Elisabeth Kübler-Ross erzählte zum Beispiel, dass ihr eines Tages, als ihr die Arbeit mit Sterbenden zuviel wurde und sie sich entschloss damit aufzuhören, im Flur ihres Krankenhauses eine ehemalige Patientin begegnete. Die Frau begleitete sie in ihr Büro und bat sie eindringlich, ihre Arbeit fortzuführen. Als Dr. Kübler-Ross ihr dies versprach, ging sie wieder. Das klingt nicht besonders ungewöhnlich - aber die Patientin war bereits ein Jahr zuvor gestorben und begraben worden.
Häufig werden solche Erfahrungen - natürlich nicht von den Betroffenen - als Phantasie, Einbildung oder Halluzination abgetan. Aber eine solche Benennung ist keineswegs schon eine Erklärung. Die Menschen sehen oder hören etwas, das zwar nicht im physischen Sinne, aber doch als Information durchaus real ist. Und diese Information muss von irgendwoher kommen, aus dem Diesseits, aus dem Jenseits, woher auch immer. Es ist durchaus denkbar, dass unser Unterbewusstsein zum Beispiel eine Warnung, die es uns zukommen lassen will, in eine Geschichte kleidet - aber wie steht es mit den zahlreichen Fällen, wo mehrere Menschen die verstorbene Person gesehen haben, oder wo Haustiere auf sie reagierten?
Bill und Judy Guggenheim, die über 3000 solcher “Nachtodkontakte” dokumentiert haben, zitieren in ihrem Buch “Trost aus dem Jenseits” folgenden Bericht einer Lehrerin über die Begegnung mit ihrem verstorbenen Bruder:
“Ich war gerade in der Küche am Werkeln. Plötzlich kam unsere Katze aus dem Wohnzimmer in die Küche geschossen. Ihr standen die Haare zu Berge und sie fauchte. Gleichzeitig verdrückte sich unser kleiner Hund bellend und mit ebenfalls gesträubtem Fell rückwärts aus dem Wohnzimmer. Ich ging nachsehen, was los war, und da saß mein Bruder Rudy im Schaukelstuhl! Er lächelte mich an. Ich war so froh ihn zu sehen! Er saß da in seinen Bluejeans und einem rotkarierten Hemd, wie er oft dagesessen hatte, als er noch lebte. Ich war ganz ruhig, ich wusste, dass es Rudy gutging. Dann löste er sich vor meinen Augen wieder in Luft auf. Ich war früher eine eingefleischte Skeptikerin, bis ich dieses Erlebnis hatte. Nie hätten ich gedacht, dass so etwas wirklich passieren kann. Wenn die Tiere nicht so reagiert hätten, hätte ich wohl angenommen, meine Phantasie wäre mit mir durchgegangen.”
Das eine ist derzeit so wenig erklärbar wie das andere - aber was ist wohl wahrscheinlicher - dass wir eine verstorbene Person wahrnehmen, weil unser Unterbewusstsein sie sich erschafft, oder weil sie tatsächlich da ist?
Indiz Nummer 2: Konkrete Erinnerungen an ein früheres Leben.
Eine Frage die oft gestellt wird, wenn es um Unsterblichkeit und Wiedergeburt geht, ist: wenn wir schon mehrfach gelebt haben, warum erinnern wir uns dann normalerweise nicht mehr daran?
Weil die Hüterinnen des Schicksals der Seele vor ihrer Wiederverkörperung einen Trank aus der Quelle des Vergessens verabreichen - meinte der griechische Philosoph Platon. Spätere Anhänger der Reinkarnationslehre haben weniger mythische Erklärungen bevorzugt, so zum Beispiel die einfache Feststellung, dass die Fülle der Erinnerungen aus früheren Existenzen uns in der gegenwärtigen am Denken und Handeln hindern würde.
Gotthold Ephraim Lessing, auch ein Anhänger der Reinkarnationslehre, schrieb zum Beispiel: “Wohl mir, das ich das vergesse. Die Erinnerung an meine vorigen Zustände würde mir nur einen schlechten Gebrauch des gegenwärtigen zu machen erlauben. Und was ich auf itzt vergessen muss, habe ich denn das auf ewig vergessen?”
Tatsächlich sind diese Erinnerungen ja offenbar nicht gänzlich verschwunden, denn man kann sie durch entsprechende meditative Übungen sich wieder zugänglich machen. Buddha sei hier als Beispiel genannt, und auch die Yoga-Sutren des Patanjali, wo solche Methoden der Rückerinnerung beschrieben werden.
Allerdings hat es auch eine Reihe von Fällen gegeben, in denen Menschen - vor allem Kinder - sich ohne irgendwelche Hilfe spontan an frühere Existenzen erinnerten. Bemerkenswert sind hier vor allem die Untersuchungen des amerikanischen Arztes Dr. Ian Stevenson, der eine Fülle solcher Reinkarnationserinnerungen von Kindern gesammelt hat. Dabei zeigten sich auch eindrucksvolle Übereinstimmungen von “Muttermalen” bei den Kindern und Wunden, die in ihrem früheren Leben zum Tod geführt hatten. Ein Kind, das mit narbenartigen Kerben auf dem Rücken zur Welt kam, erinnerte sich beispielsweise daran, dass es in seiner vorigen Inkarnation durch Axthiebe in den Rücken getötet wurde.
Über 200 solcher Fälle hat Stevenson dokumentiert. Seine Arbeit, deren wissenschaftliche Kompetenz auch von seinen schulmedizinischen Gegnern anerkannt wurde, zeigt genügend Beispiele, bei denen man die Annahme einer persönlichen Reinkarnation als einfachste und logischste Erklärung akzeptieren muss. Indiz Nummer 2 für unsere Unsterblichkeit: die Reinkarnationserinnerungen von Kindern.
Indiz Nummer 3: "Wunderkinder" kommen bereits als Genie zur Welt.
Wenn Kinder nun bisweilen ihre Erinnerungen aus früheren Inkarnationen mitbringen, wie es die Untersuchungen von Stevenson zeigen, wäre es dann nicht ebenso möglich, dass sie auch bestimmte Fähigkeiten mitbringen, die sie im Vorleben erworben haben?
Henry Ford, Erfinder der Fließbandfertigung und Schöpfer des ersten “Volksautos”, glaubte ebenfalls an Unsterblichkeit und Wiedergeburt. “Was einige für eine besondere Gabe oder ein Talent zu halten scheinen”, sagte er, “das ist nach meiner Ansicht die Frucht langer, in vielen Leben erworbener Erfahrung.” Interessant ist dieser Aspekt vor allem in Bezug auf die sogenannten “Wunderkinder”.
William Rowan Hamilton, einer der bedeutendsten irischen Wissenschaftler, konnte bereits mit drei Jahren lesen, mit fünf sprach er Lateinisch, Griechisch und Hebräisch und mit sieben auch noch Italienisch und Französisch. Als er neun war, lernte er Arabisch, Chaldäisch Syrisch und Sanskrit, danach neben anderen Sprachen Malaiisch und Bengalisch und schließlich auch noch Chinesisch.
Christian Hernaker konnte bereits wenige Stunden nach seiner Geburt sprechen und kannte mit 14 Monaten die Bibel auswendig. Geschichte, Geographie und Anatomie lernte er mit zweieinhalb Jahren und zur gleichen Zeit las er bereits Deutsch, Französisch und Latein fließend. Ein halbes Jahr später konnte er addieren, subtrahieren und multiplizieren.
Woher stammen solche außergewöhnlichen Fähigkeiten bei Kindern, zu denen natürlich auch Mozart und andere musikalische Wunderkinder zählen? Ihre Beispiele zeigen, dass es offenbar Menschen gibt, die in dem einen oder anderen Bereich bereits sozusagen ausgebildet auf die Welt kommen. Aber wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Wie und wo wurden diese Kinder ausgebildet?
Die Schulwissenschaft hat hierfür keine schlüssige Erklärung. Aber was spricht denn gegen die Annahme, dass dieses Können, das da scheinbar aus dem Nichts kommt, in einer früheren Inkarnation erworben wurde? Wenn Mozart mit vier Jahren schon so gut Klavier spielen konnte, wie ein anderer erst nach zwanzigjähriger Übung, warum sollte er dann nicht in einem früheren Leben zwanzig Jahre lang geübt haben? Warum lernen wir manche Dinge leicht und manche schwer?
Offensichtlich kommen wir nicht als “unbeschriebenes Blatt” zur Welt, und wir bringen nicht nur einen bestimmten Charakter mit und bestimmte Vorlieben und Abneigungen, sondern auch eine Prädisposition für bestimmte Tätigkeiten. Wir sprechen dann gewöhnlich von “Talent” - aber wie entsteht ein solches Talent?
In den Genen liegt es wohl nicht, denn sonst wäre Talent allgemein vererbbar, was nach aller Erfahrung aber nicht der Fall ist. Wie viele große Philosophen waren Kinder von Philosophieprofessoren? Ich habe trotz langem Suchen keinen gefunden. Sokrates war der Sohn einer Hebamme und eines Steinmetzen, und Immanuel Kants Vater war Sattlermeister.
Die Eltern ebenso wie die Kinder der Genies sind nur in den seltensten Fällen ebenfalls Genies. Die einfachste und naheliegendste Erklärung für diesen Sachverhalt ist die, dass man in einem früheren Leben bereits das gelernt hat, was man jetzt in dieses Leben als Talent mitbringt. Beweisen lässt sich diese Annahme nicht, aber sie lässt sich auch nicht ausschließen. Und das Fehlen jeder anderen befriedigenden Erklärung rückt sie durchaus in die engere Wahl. Und so kann man auch dies als ein Indiz - das Dritte - für unsere Unsterblichkeit ansehen: das Phänomen der sogenannten “Wunderkinder”.
Indiz Nummer 4: Rückführungen in ein früheres Leben, und dadurch bedingte Heilung von Krankheiten
Erinnerungen an frühere Inkarnationen sind, wenn sie nicht spontan auftauchen, wie bei Stevensons Kindern, auch immer wieder auf anderen Wegen zu Tage gefördert worden, durch bestimmte Techniken, oder auch durch bestimmte Drogen.
Der Psychologe Stanislav Grof ist zum Beispiel bei seinen Experimenten mit LSD auf Reinkarnationserinnerungen gestoßen. Chris Griscom erreichte dies durch eine besondere Art von Akupunktur. Ihre prominenteste Klientin, die Schauspielerin Shirley MacLaine hat davon in ihrem Buch “Tanz im Licht” ausführlich berichtet. Eine weiter, häufig angewendete Methode ist die Rückführung durch Hypnose oder verschiedene Entspannungstechniken. Zahlreiche solcher Rückführungen wurden durch Filmaufnahmen dokumentiert.
Eine junge Frau liegt in einem halbdunklen Raum auf einer Liege, sie atmet schwer, jammert und weint - sie ist verzweifelt, weil gerade ihr Kind gestorben ist. Allerdings nicht hier und jetzt, sondern vor 500 Jahren, im Mittelalter. Die junge Frau erlebt gerade, in Hypnose auf der Couch eines Psychologen, Szenen aus einer früheren Inkarnation. Die Emotionen, die hier zutage treten, sind - soviel ist sicher - nicht gespielt, sie sind echt und tief empfunden. Ob auch die Erinnerungen “echt” sind, ist eine immer noch strittige Frage.
Ganz offensichtlich aber hat die Thematik der Rückführungen bei der betreffenden Person einen klaren Bezug zu Problemen, die sie gerade in der Gegenwart beschäftigen. Hat also das Unterbewusstsein hier vielleicht seine Botschaften in einen privaten Spielfilm gekleidet? Hat es dabei vergessene Erinnerungen aus verschiedenen Quellen als Versatzstücke benutzt, ähnlich wie es bisweilen Tageseindrücke in seine Traumspiele hineinwebt?
Die Psychologin Dr. Helen Stewart Wambach hat Tausende von Menschen in frühere Zeiten und Leben zurückgeführt und sie anschließend Fragebögen über ihre Erlebnisse ausfüllen lassen, die sie statistisch ausgewertet hat. Es ergaben sich erstaunliche Übereinstimmungen mit historischen Fakten. Die überwiegende Mehrheit, über 70% hatten sich als Angehörige der Unterschicht erfahren, etwa 20 bis 30 % gehörten der Mittelschicht an und nur etwa 5 % der Oberschicht. Unabhängig von der gegenwärtigen Geschlechterverteilung, waren die Versuchspersonen in den Rückführungen etwa zur Hälfte Männer und zur Hälfte Frauen. Rassenzugehörigkeit, Kleidung, Nahrung und Gebrauchsgegenstände, die geschildert wurden, entsprachen ebenfalls den historischen Gegebenheiten. Diese Übereinstimmung ist schwer zu erklären, wenn man annimmt, dass es sich bei Reinkarnationserinnerungen um reine Phantasieprodukte handelt.
Andererseits hat sich gezeigt, dass im Detail ein wirklich schlüssiger Nachweis für die Richtigkeit der meisten “Reinkarnationserinnerungen” bislang nicht zu finden war. Zwar fand man immer wieder Einzelheiten, die sich nachweisen ließen, aber auch immer wieder Irrtümer, und eine 100% Übereinstimmung gab es in keinem Fall.
Ein weiteres Problem dabei liegt darin, dass eine Erinnerung aus der Vergangenheit nur dann bestätigt werden kann, wenn in der Gegenwart eine Information darüber vorhanden ist. Und dann kann man immer auch argumentieren, dass diese Information durch irgendeine Art von außersinnlicher Wahrnehmung empfangen wurde. Aber die Möglichkeit früherer Existenzen wird damit nicht widerlegt - sie kann als Erklärung der beschriebenen Phänomene nach wie vor im Spiel bleiben.
Darüber hinaus ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass durch die sogenannte “Reinkarnationstherapie”, wo Patienten mit verschiedenen Methoden in frühere Leben zurückgeführt werden, psychische ebenso wie physische Krankheiten geheilt werden konnten. Darunter auch solche, bei denen eine schulmedizinischen Behandlung über Jahre hinweg keine Erfolge erzielte. Stanislav Grof berichtet in seinem Buch “Geburt, Tod und Transzendenz” zum Beispiel von einer Patientin, die sich wegen Depressionen und Angstzuständen in psychotherapeutische Behandlung begab. Außerdem litt sie an einer chronischen Nebenhöhlenentzündung, die trotz aller ärztlichen Bemühungen nicht geheilt werden konnte. Während einer der Sitzungen geriet sie in das Erlebnis einer früheren Inkarnation, wo sie als angebliche Hexe von den Bewohnern ihres Dorfes ertränkt wurde. Nachdem sie in einem dramatischen Ausbruch von Gefühlen, unter Erstickungsanfällen und starker Absonderung von Nasenschleim diese Szene durchlebt hatte, verschwanden ihre Beschwerden. Grof betrachtete diese Erfahrung zwar nicht als Beweis für Reinkarnation, aber er musste zugeben: “Dennoch heilte dieses Erlebnis zur Überraschung aller Beteiligten ihre chronische Nebenhöhlenerkrankung, die Tanya zwölf Jahre lang gequält hatte und die auf konventionelle medizinische Behandlungsmethoden nicht ansprechen wollte.”
Inzwischen sind zahllose weitere Fälle ähnlicher Art veröffentlicht worden. Die psychologische Praxis zeigt, dass Beschwerden verschwinden, die mit traumatischen Erlebnissen zusammenhängen, wenn man diese Erlebnisse bewusst macht. Hier sind es nachweislich reale Beschwerden und reale Erlebnisse aus diesem Leben. Wenn andererseits reale Beschwerden aus diesem Leben durch Erlebnisse aus scheinbar früheren Leben ebenso zum Verschwinden gebracht werden - sollte man dann nicht annehmen, dass diese Erlebnisse ebenfalls real sind, beziehungsweise waren?
Als viertes ernstzunehmenden Indiz für unsere Unsterblichkeit notieren wir also: die Erfahrungen im Zusammenhang mit “Rückführungen in frühere Leben” und “Reinkarnationstherapie”.
Indiz Nummer 5: Nahtoderlebnisse stimmen weltweit überein.
Eindrucksvoller noch als die Reinkarnationserinnerungen sind Erlebnisse von Menschen, die “klinisch tot” waren und wiederbelebt wurden. “Klinisch tot” bezeichnet einen Zustand tiefster Bewusstlosigkeit, in dem beim Patienten keine äußeren Lebenszeichen - Atmung, Reflexe oder Herztätigkeit, zum Teil auch keine messbaren Gehirnströme - mehr vorhanden sind. Man spricht hier von “Sterbeerlebnissen” oder sogenannten “Nahtoderfahrungen”, und inzwischen haben zahlreiche Ärzte und Psychologen eine Fülle derartiger Fälle dokumentiert. 1977 wurde die “International Association for near Death Studies” gegründet und es entstand ein neuer Forschungszweig, die “Thanatologie”, die Todes- oder Nahtodforschung.
Einer ihrer großen Pioniere ist der Amerikaner Raymond Moody, Doktor der Philosophie und der Medizin. 1975 veröffentlichte er 150 Fälle von Nahtoderfahrung in seinem Buch “Life after Life” - “Leben nach dem Leben” (die deutsche Fassung hatte, etwas abweichend, den Titel “Leben nach dem Tod”). Zu seiner eigenen Überraschung hatte Moody während seiner Studien herausgefunden, dass die Nahtoderfahrungen, ungeachtet individueller Abweichungen im Detail, ein gemeinsames Grundmuster haben.
“Wir kennen dieses Grundmuster heute durch Untersuchungen aus der ganzen Welt”, sagte Moody in einem Fernsehinterview. “Die Menschen berichten, dass sie in dem Augenblick, wo ihr Herz stillsteht, ihren Körper zu verlassen scheinen und dann von oben auf die Ärzte und Schwestern herunterschauen, die mit ihrer Wiederbelebung beschäftigt sind.
Nach einer Weile nehmen sie dann eine Art Durchgang wahr, den viele als einen Tunnel beschreiben, durch den sie hindurchgehen in ein unglaublich strahlendes Licht. In diesem Licht fühlen sie sich von Liebe umhüllt, von Frieden, Wohlbehagen und einer überwältigenden Freude. Oft treffen sie in diesem Licht verstorbene Freunde oder Verwandte, die ihnen beim Übergang behilflich sind.
Im weiteren Verlauf dieser Erfahrung erleben viele einen umfassenden Lebensrückblick, in dem sie sozusagen gleichzeitig, in einem Panorama, alle Ereignisse ihres bisherigen Lebens vor sich sehen. Dabei wird ihnen klar, dass das Wichtigste in unserem Leben als Menschen darin besteht, dass wir lernen einander zu lieben.
Schließlich müssen sie zurückkehren, einigen wurde gesagt, dass ihre Zeit noch nicht gekommen sei, dass sie noch Dinge zu erledigen hätten. Die meisten sagen, dass sie nicht zurückkommen wollten, dass sie lieber dort geblieben wären. Aber sie kommen zurück, und es zeigt sich, dass eine tiefgreifende Veränderung ihrer Persönlichkeit stattgefunden hat. Sie sagen, dass die Liebe unser wertvollstes Gut sei, sie haben keine Angst vor dem Tod mehr und sie sind davon überzeugt, dass das, was wir Tod nennen, nur der Übergang in eine andere Wirklichkeit ist.”
Moodys Buch wurde ein Bestseller und bewirkte eine ganze Menge. Unter anderem veranlasste es den Herzspezialisten Dr. Michael Sabom, eine eigene Untersuchung über Nahtoderfahrungen durchzuführen. Sabom wollte ursprünglich den “Unfug”, den er bei Moody gelesen hatte, widerlegen. Er befragte über hundert Patienten, die “klinisch tot” gewesen waren - und musste am Ende feststellen, dass seine Untersuchung Moodys Berichte bestätigte. Und er war ehrlich und mutig genug, dieses Ergebnis auch zu veröffentlichen.
Alle Befragten empfanden ein Gefühl der Trennung vom Körper, sowie von Ruhe und Frieden. Etwa die Hälfte konnte präzise über die Wahrnehmung von Gegenständen oder Vorgängen, die sich während ihrer Wiederbelebung abgespielt hatten, Auskunft geben. Etwas mehr als die Hälfte der Patienten berichteten außerdem von einem “Überwechseln in eine jenseitige, transzendente Welt”, von Begegnungen mit “Geistwesen” oder verstorbenen Verwandten.
Sabom hatte als Kardiologe mehrere Wiederbelebungen mitgemacht und war mit ihrem Ablauf vertraut. Er verglich daher in seiner Studie die Aussagen der Patienten über ihre “außerkörperlichen” Wahrnehmungen mit den Operationsberichten der Ärzte und fand dabei erstaunliche Übereinstimmungen im Detail zwischen den Schilderungen der Patienten und den jeweils individuellen Operationsabläufen - Details, die medizinische Laien normalerweise nicht wissen.
“Die ganz spezifischen Einzelheiten, die sie wiedergeben konnten, überzeugten mich einfach”, erklärte Sabom. “Es war mehr als Phantasie. Das Bewusstsein ist getrennt vom Körper und seinem Gehirn und es kann sozusagen von außen wahrnehmen, was mit dem Körper geschieht. Mit meiner Studie habe ich zeigen können, dass es solche Erfahrungen während des Sterbevorgangs wirklich gibt.”
Andere Untersuchungen - die des Psychologen Dr. Kenneth Ring beispielsweise - kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Dabei finden sich auch immer wieder seltsame, anekdotische Schilderungen. Eine Patientin war zum Beispiel während ihrer “Nahtoderfahrung” außen um das Krankenhaus herumgeflogen und hatte dabei auf einem Fenstersims einen alten Tennisschuh bemerkt. Die Ärztin, der sie dies später erzählte, ging zu der angegebenen Stelle und fand tatsächlich diesen Schuh dort wieder.
Ein sehr interessanter Aspekt der “Nahtoderfahrungen” besteht darin, dass hier auch eine tiefgreifende Wandlung der Einstellung zum Leben, der sozialen Werte und der Weltanschauung bei den Nahtoderfahrenen stattfindet. So zum Beispiel ein Verschwinden der Angst vor dem Tod, eine Zunahme der Ehrfurcht vor dem Leben in jeder Form, ein größeres Selbstwertgefühl, eine Abkehr von Materialismus und Wettbewerbsdenken, eine positivere Lebenseinstellung, vermehrte Nächstenliebe und Spiritualität, Wissensdurst und nicht zuletzt die Überzeugung, dass das Leben - jedes einzelnen Lebewesens - einen Sinn hat.
Eine Nahtoderfahrene brachte aus ihrem “Dialog mit Gott” die Gewissheit mit, “es gebe nur zwei Dinge, die wir mitnehmen können, wenn wir sterben: Liebe und Wissen” - und damit die Aufforderung, sich hauptsächlich um diese beiden Aspekte zu kümmern.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass die beiden Qualitäten, die im Verlauf der Evolution der Lebewesen am deutlichsten zugenommen haben, Bewusstsein und Liebesfähigkeit sind.
Die erstaunlichen Wandlung der Werte und der Lebenseinstellung bei Nahtoderfahrenen zeigt, ganz unabhängig von ihrem kulturellen und persönlichen Hintergrund, große Übereinstimmung in allen wesentlichen Punkten. Sie ist nicht nur ein überzeugender Beleg für die Authentizität dieser Erlebnisse, sondern auch eine vielversprechende Grundlage für eine allgemein anwendbare, konstruktive Ethik.
Indiz Nummer 6: Erinnerung an Erfahrungen aus der Embryonalzeit.
Die Nahtoderfahrungen zeigen, dass unser Bewusstsein auch dann noch wach und aktiv sein kann, wenn das Gehirn sozusagen ausgeschaltet, wenn der Mensch “klinisch tot” ist. Am anderen Ende unserer Existenz belegen die Erkenntnisse der “pränatale Psychologie”, die sich mit den Erlebnissen und Erfahrungen des Menschen vor seiner Geburt befasst, dass unser Bewusstsein offenbar bereits vor der Entstehung des physischen Gehirns vorhanden ist.
Auf dem gepolsterten Boden des Therapieraums liegt ein etwa 40jähriger Mann. Er wimmert und krümmt sich vor Schmerzen. Während einer Regressionstherapie erlebt er, in allen Einzelheiten, die Szene wieder, die sich abspielte, als seine Mutter sich und ihn mit Rattengift umbringen wollte. So zu sehen auf einem Videoband, dass der Psychiater Wolfgang Holweg aufgenommen hat. Das besondere an dieser Situation ist, dass der Patient sich damals noch im Mutterleib befand, im embryonalen Zustand. Wie kommt er zu dieser Erinnerung? Eine spätere Befragung seiner Mutter, die ihm davon nichts erzählt hatte, bestätigte jedenfalls, dass seine Schilderung der Wahrheit entsprach.
Wolfgang Holweg hat diesen und andere, ähnliche Fälle untersucht und bei einigen konnte die Richtigkeit der Erinnerungen durch Recherchen bestätigt werden. Es zeigt sich hier, dass Menschen sich an Ereignisse - vor allem dramatische, wie zum Beispiel Abtreibungsversuche - erinnern können, die im embryonalen Stadium stattfanden, zu einer Zeit als das physische Gehirn noch gar nicht ausgebildet war. Wie dies geschieht, ist noch ungeklärt. Aber auch dieser Sachverhalt legt jedenfalls die Vermutung nahe, dass unser Bewusstsein mehr ist als nur ein Produkt elektrischer Aktivitäten im Gehirn. Dass es eine eigenständige Instanz ist, die vor der Geburt schon vorhanden war, und auch nach dem Tod des Körpers noch vorhanden sein wird.
Der große deutsche Philosoph Immanuel Kant war ebenfalls dieser Meinung, als er schrieb: “Der Anfang des Lebens ist die Geburt; dieses ist aber nicht der Anfang der Seele, sondern des Menschen. Das Ende des Lebens ist der Tod; dieses ist aber nicht das Ende des Lebens der Seele, sondern des Menschen. Geburt, Leben und Tod sind also nur Zustände der Seele.”
Pränatale Psychologie und Nahtoderfahrungen liefern jedenfalls auch überzeugende Indizien - Nummer fünf und sechs - für unsere Unsterblichkeit. Trotzdem: aus wissenschaftlicher Sicht gibt es gegenwärtig keinen objektiven Beweis - weder für die Unsterblichkeit der Seele, noch für eine mögliche Wiedergeburt. Ebensowenig gibt es allerdings einen Beweis dagegen. Wir können also für uns selbst frei entscheiden, ob wir daran glauben wollen, oder nicht.
Wer daran glaubt, befindet sich in bester Gesellschaft: Buddha und Pythagoras gehören dazu, Sokrates und Platon, Plutarch und Giordano Bruno, Goethe und Jean Paul, Lessing und Kleist, Herder und Kant, Schopenhauer, Nietzsche und Wagner, Longfellow, Emerson, Thoreau und Whitman, Jack London, Leo Tolstoi, Gustav Mahler, Jean Sibelius, Paul Gaugin, Gerhard Hauptmann und Wilhelm Busch, Christian Morgenstern, Hermann Hesse und Manfred Kyber. Aber auch Friedrich der Große und Benjamin Franklin, William James und C.G.Jung, David Lloyd George, Charles Lindbergh, Henry Ford und sogar der General George S. Patton - sie alle glaubten an Unsterblichkeit und Wiedergeburt.
Der deutsche Philosoph und Dichter Johann Gottfried Herder schrieb: “Unsere Seele muss sterben, sagst du, wenn der Körper stirbt? Hast du eine innere Kraft je sterben sehen? Nur das Äußere, Zusammengesetzte sahst du zerfallen. Was in mir lebt, mein Lebendigstes, mein Ewiges, kennt keinen Untergang. Kein Tod ist in der Schöpfung, nur Verwandlung. Wenn die Hülle beim Tode wegfällt, bleibt die Kraft, die schon vor dieser Hülle existierte.”
In der Physik gibt es den Satz von der Erhaltung der Energie, der besagt, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur umgewandelt werden kann. Da Masse und Energie, wie die Formel E = mc² besagt, gleichgesetzt werden können, muss es also auch einen Satz von der Erhaltung der Masse geben, demzufolge auch die Materie weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur verwandelt werden kann.
Und wenn wir sehen, dass überall da, wo geordnete Formen entstehen, neben Kraft und Stoff noch eine dritte Komponente wirksam ist, die mit Hilfe der Kraft den Stoff ordnet - ein informatives, organisierendes Prinzip, das unsere Vorfahren “Geist” genannt haben - sollte es dann nicht auch einen Satz von der Erhaltung des Geistes geben? Oder, moderner ausgedrückt, einen Satz von der Erhaltung der Information? Dem entsprechend der Geist (bzw. die Information) ebenfalls weder erzeugt noch vernichtet werden kann, sondern sich allenfalls verwandelt?
Und wenn wir einmal annehmen, dass in diesem Geist auch unser Bewusstsein enthalten ist - sollte es dann nicht auch einen Satz von der Erhaltung des Bewusstseins geben? So dass Bewusstsein ebenfalls weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur verwandelt werden kann?
Dann aber bedeutet sterben nicht verschwinden, sondern nur: sich wandeln.
Der “Tod” der Raupe ist die “Geburt” des Schmetterlings. Aber die Raupe ist nicht wirklich tot - sie hat sich nur verwandelt, sie ist: der Schmetterling.
Wo ist das Kind, das wir vorzeiten waren? Es ist nicht tot, aber es ist auch nicht mehr da: es hat sich verwandelt, entpuppt zu einem Erwachsenen. Und warum sollte es nicht noch mehrere solcher Wandlungen, solcher “Entpuppungen” geben, von denen manche uns als Tod erscheinen, solange sie noch nicht vollzogen sind?
Wenn unsere geistige Essenz gänzlich verschwinden soll, dann müsste sie sich in Nichts auflösen. Wenn sie sich in Nichts auflösen soll, dann müsste es ein Nichts ersteinmal geben. Es kann aber kein Nichts geben, denn wenn es ein Nichts gäbe, wäre es automatisch Etwas und nicht mehr Nichts. Wenn es aber kein Nichts geben kann, dann können wir - oder sonst irgend etwas - auch nicht vernichtet werden: “Kein Tod ist in der Schöpfung, nur Verwandlung.” Oder, wie es die Bhagavadgita sagt: “Es gibt kein Werden aus dem Nichts, noch wird zu Nichts das Seiende.”
Dies aber bedeutet, dass in der Tat jene recht haben, die da sagen: “Du lebst nur einmal”. Ja - und zwar für immer. Wir werden niemals aufhören zu leben, wir werden daher auch niemals aufhören zu wachsen, uns zu entwickeln, uns zu verwandeln - in andere Formen und Gestalten, von denen wir jetzt noch nicht einmal träumen können.
Zurück zum Inhalt
Lernen in Freiheit und Selbstveranwortung: Maria Montessoris pädgogische Alternativen
© Reinhard Eichelbeck
Erschien in "BIO" 1 / 2004
Als sie, die Schultüte im Arm, am Tag ihrer Einschulung in die Kamera des Fotografen lächelte, war für Hanna die Welt noch in Ordnung. Aber bereits ein paar Monate später war ihr die Schule verleidet. Etwas langsamer und schüchterner als die anderen Kinder, war sie immer unsicherer und ängstlicher geworden. Ihre Lehrerin antwortete darauf mit Vorwürfen und Spott nach dem Motto “Stell dich nicht so an”, was die Situation nur noch verschlimmerte.
Hanna zeigte zunehmend weniger Lust, morgens aufzustehen, sie flüchtete sich immer wieder in kleine Unpässlichkeiten, wie Kopfweh oder Magenbeschwerden, einziger Lichtblick waren die Wochenenden und Ferienzeiten. Auf der Suche nach einer Lösung für Hannas Schulprobleme entdeckten ihre Eltern schließlich die Montessori-Pädagogik. Eine Freundin machte sie darauf aufmerksam und versorgte sie mit entsprechender Literatur.
“Es war für uns wie eine Erlösung”, sagt Hannas Mutter rückblickend. Sie hospitierte einige Tage in einer Montessorischule und war begeistert. Hanna ebenso, nachdem sie einen Tag Probeunterricht mitgemacht hatte. “Da will ich hin”, sagte sie und blühte regelrecht auf, nachdem sie am Ende der ersten Klasse den Schulwechsel vollziehen konnte.
Kein Wunder - denn hier fand sie eine Schule, in der die Kinder im Mittelpunkt stehen und nicht Lehrer und Lehrplan, wo es keine Noten gibt und keine festgelegten Stundenpläne, wo jedes Kind sich frei bewegen und seine Tätigkeit selbst wählen kann.
In der Montessorischule in Inning am Ammersee, in die Hanna überwechselte, findet täglich von viertel nach 8 bis zur großen Pause um halb 11 die sogenannte “Freiarbeit” statt. Hier wird zum Beispiel eine Einführung ins Lesen, Schreiben und Rechnen gegeben, es werden Informationen angeboten aus dem Bereichen Biologie, Physik, Geschichte oder Geographie, mit deren Hilfe die Kinder sich ihre Welt erschließen können. Sie dürfen aber auch, wenn sie wollen, einfach spielen, im Musikraum Musik machen, draußen herumtoben oder sich einfach in den Kuschelraum zurückziehen und sich ausruhen.
Nach der Pause werden verschiedene sogenannte “Projekte” angeboten, für die sich die Kinder anmelden können: Musik, Sport, Töpfern, Theaterspielen, Werken oder Weben, Mitarbeit an der Schülerzeitschrift oder Unterricht von Fremdsprachen wie zum Beispiel Englisch.
Die Kinder entscheiden selbst, was sie tun wollen und lernen so, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Die Lehrerinnen helfen, wenn sie darum gebeten werden, beantworten Fragen und klären Konflikte, halten sich aber im übrigen zurück und vermeiden es, die Kinder in irgendeine Richtung zu drängen.
Nicht nur die Lerninhalte, sondern auch ihr Lerntempo bestimmen die Kinder selbst. Da alle 4 Jahrgänge der Grundschule in einer Klasse zusammengefasst sind, können Schüler, die schneller vorankommen wollen, sich an Ältere anschließen und beispielsweise schon in der zweiten Klasse Themen bearbeiten, die allgemein erst in der dritten angeboten werden.
Andererseits können Kinder, die langsam vorankommen, in der zweiten Klasse sich noch mit dem Stoff der ersten Klasse beschäftigen. Da es keine Noten gibt, gibt es auch keine Konkurrenz und die Kinder lernen eher, sich gegenseitig zu helfen, als sich zu bekämpfen und Schwächere beiseite zu drängen.
Natürlich gibt es auch hier immer wieder mal Streit und Geschubse, aber jene harte Aggression, die heute an den Regelschulen leider oft die Regel ist, findet man hier nicht. Die Kinder sind freundlicher und ausgeglichener, vor allem auch deshalb, weil man sie ernst nimmt, sich um ihre individuellen Belange kümmert und mehr Wert auf ihre persönliche Entwicklung legt, anstatt sie um jeden Preis mit Sachwissen vollzustopfen, egal ob sie das nun wollen oder nicht.
Allerdings muss die Mehrheit der Kinder am Ende der 4. Klasse ins staatliche Schulsystem überwechseln, da es derzeit zu wenig weiterführende Montessori-Schulen gibt. Aber die Erfahrung zeigt, dass sie dies ohne Probleme bewältigen können und dann oft, nach einer kurzen Anpassungszeit, zu den besten Schülern gehören, weil ihr Selbstbewusstsein stark, und ihre Kreativität ungebrochen ist.
Ein besonders wichtiger Grundsatz der Montessori-Pädagogik ist der unbedingte Respekt vor der Individualität des Kindes, die sich möglichst frei entfalten soll. Ein anderer, ebenso wichtiger ist das Vertrauen darauf, dass jedes Kind ein ursprüngliches und elementares Bedürfnis hat, Neues zu erfahren und von sich aus um so besser lernt, je mehr man ihm die Möglichkeit gibt, dabei seinem eigenen Rhythmus zu folgen.
“Hilf mir, es selbst zu tun”, ist einer der zentralen Leitsätze. Und auch: “Ich bin wichtig. Ich trage für mich selbst die Verantwortung. Ich habe die Freiheit mich zu entfalten, zu entwickeln. Andere trauen mir zu, dass ich Probleme alleine lösen kann. Wenn ich einmal nicht mehr weiter weiß, kann ich andere bitten mir zu helfen.”
Charakteristische Merkmale der Montessori-Methode sind neben diesen Grundsätzen vor allem die besondere Struktur des Unterrichts und ein System spezieller didaktischer Materialien, durch die ein ganzheitliches Lernen gewährleistet wird, ein Lernen mit “Kopf, Herz und Hand.”
Entwickelt wurde diese wohl weltweit erfolgreichste Methode des alternativen Lernens Anfang des 20sten Jahrhunderts von der italienischen Ärztin und Pädagogin Maria Montessori. Wie zahlreiche andere Menschen, die ihrer Zeit voraus waren, führte auch sie ein Leben, das in vielerlei Hinsicht einem Abenteuer glich - nicht in fernen Urwäldern oder Wüsten, sondern mitten in der abendländischen Zivilisation.
Ein Leben voller erstaunlicher Entdeckungen, Erfolge und Rückschläge, voller Umbrüche, Konflikte und Neuanfänge. Immer aber und unter allen Umständen auf das eine, klare Ziel gerichtet; den Kindern, wo auch immer in der Welt, zu helfen, frei und selbstverantwortlich zu wachsen und sich zu ihrer eigenen Individualität zu entfalten. Etwas, das sie selbst sich noch unter großen Mühen und Anstrengungen erkämpfen musste.
Aufgewachsen in einer Familie, die zur sozialen und politischen Elite Italiens gehörte, traf sie im Alter von 12 Jahren eine bemerkenswerte und - für die damalige Zeit - höchst ungewöhnliche Entscheidung: sie beschloss, Ingenieur zu werden. Und ihre Eltern gaben diesem Wunsch nach - ebenfalls höchst ungewöhnlich für die damalige Zeit, in der eine Frau als Ingenieur etwas nahezu Undenkbares war.
Um sich für diese Laufbahn zu qualifizieren, musste Maria die nächsten Jahre auf einer Jungenschule verbringen. Und die Knaben dort betrachteten den Einbruch des anderen Geschlechts in ihre geheiligte Domäne als eine Provokation, die sie nur mit Aggressivität zu beantworteten wussten. Maria und ein zweites Mädchen, das ihr Schicksal teilte, mussten daher in den Pausen im Klassenzimmer eingeschlossen werden, um vor den Belästigungen ihrer Mitschüler sicher zu sein.
Hinzukam noch, dass der Unterricht all die Merkmale aufwies, die Maria Montessori später angeprangert und in ihrer Methode vermieden hat: er war eintönig, streng und theoretisch, der Lehrstoff musste passiv und ohne Widerspruch einfach aufgenommen werden. Neugier, eigene Initiative und Experimentierlust wurden unterdrückt.
Aber Maria kämpfte sich durch. Sie war offenbar ein Mensch, der am Widerstand wächst und durch Schwierigkeiten angespornt wird. Jedenfalls schrieb sie viele Jahre später, als alte Frau einer Freundin: “Es geht mir gut, aber meine Lebendigkeit und mein Vertrauen nehmen allmählich ab. Vielleicht liegt es daran, dass alles sehr gut läuft und ich keine Spannungen erlebe. Mir fehlt der Ansporn durch den Kampf”.
Nachdem sie 1890 mit guten Noten ihr Abschlussexamen gemacht hatte, änderte Maria Montessori allerdings plötzlich ihre Meinung und beschloss, Medizin zu studieren. Auslöser für diesen Sinneswandel war die Begegnung mit einer Bettlerin, die sie während eines Spaziergangs am Straßenrand sitzen sah, ein kleines Kind auf dem Schoß, das mit einem roten Papierfetzen spielte. Und mit einem Mal, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, traf Maria Montessori die Erkenntnis, dass sie ihr Leben nicht den Maschinen, sondern den Menschen widmen wollte.
Und mit der ihr eigene Konsequenz setzte sie ihr Vorhaben sogleich in die Tat um. Allerdings nicht ohne Schwierigkeiten, denn auch hier war sie im Begriff, in einen Bereich einzubrechen, der den Männern vorbehalten war. Um zugelassen zu werden, brauchte sie eine besondere Genehmigung des Kultusministers - die dieser ersteinmal verweigerte.
Was anschließend geschah, bleibt ein Geheimnis - vielleicht hat ihr Vater, der eine wichtige Stellung im Finanzministerium innehatte, seinen Einfluss geltend gemacht - jedenfalls konnte Maria Montessori im Herbst 1892 mit ihrem Medizinstudium beginnen. Als einzige Frau unter lauter Männern, die sie wiederum als unerwünschten Eindringling betrachteten, hatte sie es nicht leicht. Aber einschüchtern ließ sie sich nicht, und beendete ihr Studium mit Bravour.
1896 trat sie eine Stellung als Assistenzärztin in der psychiatrischen Klinik der Universität von Rom an. Gleichzeitig war sie in der Frauenbewegung aktiv und erregt durch ihre radikalen Ansichten Aufsehen. Auf dem Berliner Kongress des gleichen Jahres forderte sie für die Frauen das Recht auf gleiche Arbeit und gleiche Entlohnung wie die Männer. Über die sie sich nicht gerade schmeichelhaft äußerte: “Der Mann ist kein Kavalier”, sagte sie, “er betrachtet die arbeitende Frau entweder als Rivalin oder als Beute.”
Während ihrer Tätigkeit in der psychiatrischen Universitätsklinik kam Maria Montessori mit geistig behinderten Kindern in Kontakt und begann, sich mit ihnen zu beschäftigen und nach möglichen Methoden zu suchen, wie man ihre Erziehung und Entwicklung fördern könnte.
Hier begann der Weg, der nach vielen Jahren voller Beobachtungen, Forschungen und intuitiven Erkenntnissen zu jenem System führte, das seine Erfinderin weltweit berühmt und zur bedeutendsten Pädagogin der Neuzeit machte: die “Montessori-Methode”.
Im Jahre 1906 hatte der Bankier Eduardo Talamo im römischen Arbeiterviertel San Lorenzo einen Komplex von Appartementhäusern für Familien mit Kindern erstellen lassen - ein frühes Beispiel für sozialen Wohnungsbau. Da meist beide Eltern arbeiteten, waren die Kinder tagsüber sich selbst überlassen, trieben Unfug und richteten einigen Schaden an. Talamo beschloss, dem durch Einrichtung einer Art Kinderkrippe abzuhelfen, und bat Maria Montessori, diese Aufgabe zu übernehmen. Maria griff sofort zu, denn hier bot sich ihr eine Gelegenheit, die pädagogischen Ideen, die sie inzwischen entwickelt hatte, in der Praxis zu erproben.
Die Jahre davor waren für sie Jahre des Umbruchs gewesen, Jahre der inneren Suche und Entwicklung, verbunden mit Konflikten und Enttäuschung. 1898 hatte Maria Montessori eine Liebesaffäre mit ihrem Kollegen Giuseppe Montesano und wurde schwanger. Aber eine Heirat - die naheliegende Konsequenz - kam nicht zu Stande, und eine unverheiratete Mutter zu sein, war seinerzeit für eine Frau in Marias Position undenkbar. Sie verheimlichte ihre Schwangerschaft und auch die Geburt eines Sohnes, der den Namen Mario bekam und zu einer Familie auf dem Lande in Pflege gegeben wurde, wo er 15 Jahre lang blieb. Maria besuchte ihn regelmäßig, aber dass sie seine Mutter war, sagte sie ihm nicht.
Mag sein, dass es diese Belastung war, die sie dazu trieb, sich nun besonders intensiv auf die Arbeit mit behinderten Kindern zu konzentrieren. 1899 wurde sie Codirektorin einer Schule, die Lehrkräfte für Behindertenerziehung ausbilden sollte. Ein Jahr später wurde sie auch Dozentin für Hygiene und Anthropologie an der Hochschule für Frauen in Rom. Gleichzeitig belegte sie Vorlesungen in Pädagogik und engagierte sich in der Frauenbewegung.
Sie schreib Artikel, hielt Vorträge und richtete mit anderen zusammen eine Petition an das italienische Parlament, die das Wahlrecht für Frauen forderte. Sie beschäftigte sich mit östlicher Philosophie, Theosophie und der experimentellen Psychologie Wilhelm Wundts. Vor allem aber studierte sie die Arbeiten des französischen Psychologen Edouard Séguin. Der hatte sich schon Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Erziehung behinderter Kinder befasst und auch verschiedenes didaktische Material entwickelt, mit dem er überraschende Erfolge erzielte.
Während sie Séguins Erfahrungen nachvollzog, kam Maria Montessori immer mehr zu der Überzeugung, dass seine Methode auch bei “normalen” Kindern anzuwenden wäre und hier noch größeren Erfolg haben müsste. Das Angebot des Bankiers Talamo gab ihr nun die Chance, ihre Ideen praktisch umzusetzen.
Im Januar 1907 startete sie in San Lorenzo mit 50 Kindern das erste Kinderhaus, das “Casa dei Bambini”, die Keimzelle der späteren Montessori-Schulen.
Maria Montessori ließ kleine, kindgerechte Möbel anfertigen und eine Küche einrichten, in der das Essen für die gemeinsame Mahlzeit zubereitet werden konnte. Herkömmliches Spielzeug lehnte sie ab, da es ihrer Meinung nach eher die “Gier nach Besitz” weckte, und nicht das Verlangen nach “aufbauender Arbeit”. Statt dessen gab sie den Kindern das didaktische Material von Séguin, beobachtete, wie sie damit umgingen, und entwickelte, indem sie es verbesserte und erweiterte, daraus das bekannte Montessori-Material - Holzobjekte, Zeichenfiguren, farbige Fäden, Geräuschdosen, Perlenstäbe zum Rechnen, Buchstaben aus Schmirgelpapier und anderes mehr.
Mindestens ebenso wichtig wie das Material war aber auch die Art und Weise, wie sie mit ihren Schützlingen umging. Durch ihre Beobachtungen erkannte Maria Montessori, dass die Kinder nicht bedient werden, sondern möglichst alles selber machen wollten: “Lässt man dem Kind nur ein klein wenig Spielraum”, so schrieb sie, “so wird es den Willen zur Selbstbehauptung sogleich mit einem Ausruf kundgeben, wie Das möchte ich tun, ich! In den kindgemäßen Umgebungen unserer Kinderhäuser haben die Kleinen ihr inneres Bedürfnis mit dem bezeichnenden Satz ausgedrückt: Hilf mir, es allein zu tun.”
Sinnvolle pädagogische Hilfe kann nur indirekte Hilfe zur Selbsthilfe sein, und in diesem Sinne sagte Maria Montessori den Frauen, die sie später zu Lehrerinnen ausbildete: “Der Lehrer muss sich still und passiv verhalten, so dass der Geist des Kindes sich frei entfalten kann.” Jedes Kind hat sein eigenes Lerntempo, seinen eigenen Lernrhythmus. Seine Individualität ist zu respektieren und zu fördern, und es soll sich frei entfalten können.
Das Kind muss auch die Möglichkeit haben, sich frei zu bewegen, denn “Beobachtungen an Kindern aus aller Welt beweisen, dass das Kind seine Intelligenz durch Bewegung entwickelt,” so schreibt sie. Und auch: “Das Kind muss sich immer bewegen, kann nur aufpassen oder denken, wenn es sich bewegt. Es hat uns selbst dieses Bedürfnis offenbart, und zwar dadurch, dass wir ihm die Freiheit zur Äußerung ließen.”
Maria Montessori beschreibt auch, welche Folgen es hat, wenn man den Kindern die Möglichkeit der freien Selbstentfaltung verweigert, und ihre Äußerungen klingen erschreckend aktuell: “Vor allem in der Bewegung des Kindes sind Symptome erkennbar: Hände, die nicht arbeiten, aber auch nicht ruhig sein können; hastige Bewegungen, die alle Dinge der Umgebung gefährden; Zerstreutheit, Schüchternheit, Unaufmerksamkeit und vieles andere. Die Bewegungen sind meist überlebhaft, ungeordnet und zwecklos. Sie sind nicht fähig, ausdauernd und aufmerksam zu sein. Sie sind uninteressiert für alles, was gelehrt wird.”
Heute hat man für diese Form der Verhaltensstörung einen neuen Namen: “Hyperaktivität”. Aber der Umgang damit ist nicht anders als zur Zeit von Montessoris Anfängen: “Der Erwachsene”, so schreibt sie, “denkt nicht daran, einen ungeordneten Organismus, der seine normale Funktion verloren hat, zu ordnen, sondern er versucht nur, die Symptome zu unterdrücken.” Ausgetauscht hat man allerdings das Werkzeug der Unterdrückung - statt des Rohrstocks nimmt man heute Ritalin. Sollte man das für einen Fortschritt halten?
Verhaltensstörungen von Kindern sind in den meisten Fällen keine Krankheit, sondern eine Überlebensstrategie. Ein Baum, der am natürlichen Wachstum gehindert ist, zum Beispiel durch einen Drahtzaun, entwickelt Wucherungen und Verwachsungen - aber nicht weil er krank ist. Er verkrüppelt sich, um zu überleben, um weiter wachsen zu können. Und bei den Kindern ist es nicht anders. Es ist nicht nötig, sie zu therapieren, es genügt, ihre Umgebung entsprechend zu verändern und das Verhalten der Erwachsenen ihnen gegenüber.
Die Pädagogin Rebecca Wild, die in Ecuador eine freie Schule nach den Montessori-Prinzipien betreibt, berichtet, dass hyperaktive Kinder, die zu ihr kamen, sich bereits nach wenigen Wochen “normalisiert” haben, ohne dass man besondere Maßnahmen ergreifen musste.
Seit den Zeiten des ersten “Casa dei Bambini” hat sich viel verändert. Die festen Bänke sind auch aus den Regelschulen verschwunden und haben Tischen und Stühlen Platz gemacht. Trotzdem wird von den Kindern immer noch verlangt, während des Unterrichts still auf ihren Plätzen zu bleiben, ihr Aktionsradius ist mehr oder weniger auf die Sitzfläche ihres Stuhles beschränkt.
Selbst Käfighühner in einer Legebatterie haben, im Verhältnis gesehen, einen größeren Bewegungsspielraum. Und wenn die Schüler Hühner wären, hätte sicherlich schon die eine oder andere Tierschutzorganisation Einspruch erhoben. Es wird heute sehr viel über “artgerechte Tierhandlung” diskutiert - vielleicht sollte man zur Abwechslung auch einmal etwas gründlicher über “artgerechte Menschenhaltung” nachdenken.
Kommunikationswissenschaftler haben durch Untersuchungen herausgefunden, dass Lernen durch bloßes Hören einen Wirkungserfolg von etwa 20% hat, Lernen durch Lesen rund 30%, und durch eine Verbindung von Hören und Lesen kommt man auf etwa 50%. Lernen durch aktives Handeln hingegen hat eine Erfolgsquote von 90%! In die Entscheidungsetagen der Schulbürokratie ist diese Erkenntnis offenbar noch nicht vorgedrungen.
Lernen - so erkannte Maria Montessori - ist nicht nur eine Sache des Kopfes (Denken), sondern auch des Herzens (Fühlen) und der Hand (Handeln). Berührung ist wichtig, um die Dinge zu er-fassen, denn was man anfasst, kann man besser be-greifen. Der Tastsinn erhielt in Montessoris System dementsprechend einen hohen Stellenwert, denn sie meinte, er sei “beim modernen Kulturmenschen von Auge und Ohr zu Unrecht überwuchert.”
Ein besonders gute Beispiel für dieses “Sinnesmaterial” waren aus Sandpapier geschnittene Buchstaben, und mit ihnen gelang Maria Montessori etwas, das als “Lernwunder” und “Schreibexplosion” bald Schlagzeilen machte. Bereits im Dezember 1907 begannen Kinder, die mit diesen Buchstaben spielten, Worte zusammenzusetzen, und schon bald konnten sie schreiben und lesen - während ihre Eltern fast alle noch Analphabeten waren.
Montessoris Erfolge erregten großes Aufsehen, und 1908 wurde ein weiteres Kinderhaus in Mailand eröffnet. Ein Jahr später veröffentlichte sie ein Buch über ihre Arbeit und ihre neue Erziehungsmethode: Il metodo. 1912 erschienen eine englische und eine französische Übersetzung, die deutsche, polnische und russische folgten 1913, die japanische, rumänische, irische und spanische 1914 und 1915 und eine niederländische 1916.
Montessoris Arbeit zog immer weitere Kreise. 1910 fasste sie den Entschluss, ihren Arztberuf aufzugeben und sich nur noch der Pädagogik zu widmen. In Rom wurde eine Montessori-Vereinigung gegründet, die Unterabteilungen in Mailand und Neapel bekam. Von 1911 an wurde ihre Methode in italienischen Grundschulen eingeführt, und eine eigene Ausbildungsstätte für Montessori-Lehrerinnen wurde eingerichtet, die von Frauen nicht nur aus Italien besucht wurde.
In den USA kam es zu einem regelrechten “Montessori-Boom”. Die englische Übersetzung ihres Buches wurde ein Bestseller, und die Vortragsreise, zu der man Maria eingeladen hatte, ein triumphaler Erfolg. Die Presse kündigte sie enthusiastisch an als “die interessanteste Frau Europas”, und mit ihren Vorträgen und Lesungen füllte sie vielfach große Theatersäle. Höhepunkt war ein Auftritt in der vollbesetzten Carnegie Hall in New York, wo sie als “größte Pädagogin der Geschichte” vorgestellt wurde.
Nicht umsonst hatte Maria schon als Kind den Wunsch geäußert, Schauspielerin zu werden. Sie besaß offensichtlich ein beachtliches theatralisches Talent, und das konnte sie hier voll ausleben. Die starke Ausstrahlung ihrer Persönlichkeit beeindruckte die Menschen und verschaffte ihr zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger, die ihre Arbeit unterstützen wollten. Sie traf unter anderem mit Präsident Wilson zusammen, mit Helen Keller, Thomas A. Edison und Alexander Graham Bell.
Bell, der als Erfinder des Telefons berühmt wurde, war Taubstummenlehrer, und hatte sich schon vor Marias Reise für die Montessori-Methode interessiert und für die Möglichkeit, sie auch im Unterricht von Tauben und Schwerhörigen anzuwenden. Seine Frau Mabel war Präsidentin der Anfang 1913 gegründeten Montessori Educational Association of America und das Ehepaar Bell hatte dafür gesorgt, dass in ihrem Haus in Washington eine Montessori-Klasse eingerichtet werden konnte.
Sogar auf der Weltausstellung, die 1915 in San Franciscostattfand, wurde die Montessori-Methode vorgestellt. Man hatte dort einen riesigen Palace of Education geschaffen, und während etwa 35 Kinder zwischen drei und sechs Jahren sich in einem gläsernen Pavillon mit dem Montessori-Material beschäftigten, standen interessierte Eltern und Besucher auf der anderen Seite der Glasscheibe und schauten “wie Touristen auf ein Aquarium.”
Ende 1915 kehrte Maria Montessori nach Europa zurück, allerdings nicht nach Italien, das inzwischen in den 1. Weltkrieg eingetreten war, sondern ins neutrale Spanien, nach Barcelona. Ihr Sohn Mario, den sie inzwischen zu sich genommen, und der sie auf dieser Reise begleitet hatte, blieb bis 1918 in Kalifornien, wo er eine Montessori-Klasse einrichtete für die Kinder berühmter Filmstars, wie zum Beispiel Douglas Fairbanks und Mary Pickford.
Fast zehn Jahre lang blieb nun der Schwerpunkt von Montessoris Aktivitäten in Barcelona. Finanzielle Unterstützung durch die Regierung erlaubte ihr die Gründung einer Montessori-Modellschule, die als “Versuchsgelände” und internationales Trainingszentrum dienen konnte.
Marias Erfolgssträhne hielt an. Papst Benedictus XV. veranlasste nach einem Gespräch mit ihr, dass sämtliche Montessori-Bücher in die vatikanische Bibliothek aufgenommen wurden und erteilte ihr seinen päpstlichen Segen. Sie experimentierte nun auch mit christlich-religiöser Erziehung für Kinder und richtete in Barcelona eine spezielle Kapelle für Kinder ein, wo diese aktiv am Ritual der heiligen Messe teilnehmen konnten.
Einige Jahre später allerdings geriet Marias Beziehung zur Kirche in eine Krise, weil sie sich strikt weigerte, das Dogma von der Erbsünde anzuerkennen - das ja im übrigen auch nicht von Jesus selbst stammt, sondern von Augustinus. “Lästige Eigenschaften” von Kindern waren in Montessoris Augen keineswegs Zeichen irgendeiner ererbten oder sonstigen “Sünde”, sondern vielmehr “nichts anderes als ein Verteidigungsmechanismus, eine Reaktion auf die Versuche von Erwachsenen, sich ihrer Seele zu bemächtigen.”
1923 wurde die Lage in Spanien problematisch, als nach einem Regierungswechsel die Geldmittel gestrichen wurden. 1924 musste die Modellschule geschlossen werden und Marias Aktivitäten verlagerten sich nach England, den Niederlanden und auch wieder nach Italien.
Im Frühjahr 1924 kam es zu einer Begegnung mit Mussolini. Der Diktator fand es opportun, sich mit dem Namen der Pädagogin zu schmücken und sagte ihr seine Unterstützung zu. Die Opera Nazionale Montessori wurde gegründet, eine Institution die mit Geldern der Regierung Montessori-Schulen gründete, Trainingskurse organisierte, Lehrmittel herstellen und Neuauflagen von Marias Büchern drucken ließ. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Montessori-Methode, die zur “nationalen Erziehungstheorie” erklärt worden war, an etwa 70 Kindergärten und Grundschulen in ganz Italien angewendet.
Allerdings gab es auch hier nach einiger Zeit Probleme, weil Maria Montessori in ihren Vorträgen immer konsequent für den Frieden eintrat und das soldatische Gehabe der Faschisten verabscheute. Sie trat auch auf internationalen Friedenskongressen im Ausland auf und betonte, die wahre Heroik sei eine Heroik die Leben schaffe, und nicht eine, die Leben vernichte. Außerdem zeigte sie keine national-italienische Haltung, sondern sprach statt dessen von einem “universellen Vaterland der ganzen Menschheit”.
Und nicht zuletzt wurde den Faschisten wohl auch klar, dass die Montessori-Methode die Kinder nicht zu gehorsamen Befehlsempfängern erziehen wollte, sondern zu freien, selbständigen, selbstbewussten und selbstverantwortlichen Menschen. Und solche Menschen hat keine Regierung gern, am allerwenigsten eine diktatorische. Es ist bezeichnend, dass beispielsweise Stalin in Russland die Montessorischulen verbot, die dort auf Initiative von Lenin eingerichtet worden waren.
Auch in Deutschland wurden bald nach Hitlers Machtergreifung die Montessorischulen geschlossen, verdammt als Werkzeuge der “zersetzenden Macht des Individualismus”. Wer eine solche Erziehung fördert, so stand im Westdeutschen Beobachter zu lesen, der “empfindet nicht deutsch - und nicht natürlich...”
1934 kam es zum endgültigen Bruch zwischen Maria Montessori und den Faschisten. Sie zog sich aus allen Ämtern zurück, verließ Italien und ging wieder nach Barcelona, wo die Verhältnisse sich nach einem Regierungswechsel gebessert hatten. Leider nur für kurze Zeit, denn 1936 begann der spanische Bürgerkrieg und Maria begab sich auf dem Umweg über England in die Niederlande.
Dort war sie schon mehrfach gewesen, das erste Mal 1914, und hatte bei zahlreichen Menschen das Interesse an ihrer Methode geweckt. Bereits 1917 hatte eine Elterninitiative die niederländische Montessori-Vereinigung gegründet, die 1935 etwa tausend Mitglieder zählte. Über 28 Städte verteilt gab es zweihundert Montessori-Schulen mit sechstausend Schülern. Und in Amsterdam war 1930 sogar ein Montessori-Gymnasium entstanden.
Maria Montessori war gerade im Begriff, sich in Holland eine neue Heimat zu schaffen, als sie eine Einladung der Theosophischen Gesellschaft nach Indien rief. Auch dort war mittlerweile ein lebhaftes Interesse an ihrer Methode gewachsen, und man versprach sich von ihrer Anwesenheit entscheidende Impulse.
Da sie Indien in gewisser Weise als ihr “geistiges Vaterland” betrachtete, nahm Maria die Einladung an und erreichte im Oktober 1939 in Begleitung Marios die Stadt Adyar, wo sich der Sitz der Theosophischen Gesellschaft befand. Dort begann sie bald darauf mit einem Trainingskurs für 300 indische Lehrkräfte. Trotz ihrer fast 70 Jahre und der ungewohnten Hitze genoss sie diese neue Arbeit. Aber wieder zogen dunkle Wolken auf.
1940 trat Italien in den 2. Weltkrieg ein, und da Indien Teil des britischen Imperiums war, wurden Maria und Mario zu Mitgliedern einer feindlichen Nation, und nur dem Einspruch englischer Montessori-Freunde war es zu verdanken, dass Maria nicht interniert wurde, sondern sich in Adyar frei bewegen konnte. Bis zum Ende des Krieges allerdings mussten Mutter und Sohn in Indien bleiben. In dieser Zeit bildete Maria Montessori mehr als tausend indische Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Methode aus.
1946 kehrte sie nach Holland zurück, wo sie bis zu ihrem Tod im Jahre 1952 blieb, unermüdlich weiter an der Verbreitung ihrer Methode und der Idee einer freien Kindererziehung arbeitend.
Auf ihrem Grabmal in Noordwijk, einer halbkreisförmigen Mauer aus unpoliertem Marmor, steht eine Inschrift in italienischer Sprache: “Io prego i cari bambini che possuno tutto di unirsi a me per la construzione della pace negli uomini nel mondo.” Auf deutsch: “Ich bitte die lieben Kinder, die alles vermögen, sich mit mir zu vereinigen, um den Frieden in den Menschen und in der Welt aufzubauen”.
Das ungeheure Vertrauen, das sie in die Kinder hatte, und das die Grundlage ihrer Pädagogik ist, spricht ebenso aus diesen Worten, wie die noch kaum verstandene Erkenntnis, dass es keinen Frieden in der Welt geben wird, solange man die Kinder nicht in Frieden lässt. Solange man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, sich frei und dem eigenen Wesen gemäß zu entfalten - denn nur so werden sie als Erwachsene die Sicherheit und Ausgeglichenheit haben, um auch in kritischen Situationen friedlich und vernünftig zu handeln.
Montessoris Werk ist auch jetzt, mehr als ein halbes Jahrhundert später, immer noch sehr aktuell und auch sehr lebendig. Allerdings hauptsächlich auf der Basis privater Initiativen. In die staatlichen Schulen Deutschlands hat es, trotz einiger Ansätze, noch keinen Eingang gefunden.
Warum ist das so? Die Wirksamkeit von Montessoris Methode ist unbestritten, ihr Erfolg eindeutig belegt. Warum wird sie nicht in die Regelschulen übernommen? Ist es ein Mangel an Vertrauen in die Selbsterziehungsfähigkeit des Kindes? Oder will der Staat einfach keine selbständigen, selbstbewussten und selbstverantwortlichen Menschen - die ja das Erziehungsziel der Montessori-Methode darstellen? Erziehung zum Frieden und zur Freiheit war Montessoris Anliegen - ist das immer noch weniger wichtig, als die Kinder in “Belehrungskäfigen” mit Sachwissen zu mästen?
“Wie können wir Demokratie erwarten”, schrieb Maria Montessori, “wenn wir Sklaven aufgezogen haben? Wirkliche Freiheit beginnt am Anfang des Lebens, nicht erst, wenn wir erwachsen sind.”
Es wäre an der Zeit, solche Fragen nicht nur zu stellen, sondern auch zu beantworten. Es wäre an der Zeit, das Kind als eigenständiges, individuelles Wesen zu respektieren, in all seinen Aspekten, egal ob der jeweilige Zeitgeist sie positiv bewertet oder negativ. Das 20ste Jahrhundert war nicht “Das Jahrhundert des Kindes”, wie es die Lehrerin und Schriftstellerin Ellen Key 1902 erhoffte. Das 21ste Jahrhundert könnte es, und sollte es endlich werden.
Zurück zum Inhalt
Die Forschungen und Erfahrungen der Gärtnerin Maria Thun
© Reinhard Eichelbeck
Erschien in "BIO" 2 / 2004
Sie ist mittlerweile 81 - aber kein bisschen müde und noch lang nicht gewillt, sich aufs Altenteil zu begeben - die Gärtnerin Maria Thun.
 “Es gibt noch soviel zu erforschen...”, meint sie.
Und dabei hat sie schon sehr viel erforscht und herausgefunden: seit über 50 Jahren untersucht sie die Einflüsse kosmischer Kräfte auf das Wetter und das Wachstum von Pflanzen. Und sie entwickelte auf Grund ihrer Erfahrungen eine sehr erfolgreiche Methode der ökologischen Gartenbearbeitung, mit der sich Ertrag und Qualität von Nahrungspflanzen erheblich steigern lassen.
“Es gibt noch soviel zu erforschen...”, meint sie.
Und dabei hat sie schon sehr viel erforscht und herausgefunden: seit über 50 Jahren untersucht sie die Einflüsse kosmischer Kräfte auf das Wetter und das Wachstum von Pflanzen. Und sie entwickelte auf Grund ihrer Erfahrungen eine sehr erfolgreiche Methode der ökologischen Gartenbearbeitung, mit der sich Ertrag und Qualität von Nahrungspflanzen erheblich steigern lassen.
Schuld an allem waren, wenn man so will, einige Dutzend Radieschen. Maria Thun hatte sie 1952 in ihrem Garten ausgesät, und sie entwickelten sich - obwohl von gleicher Sorte, im gleichen Beet gesät und gleich behandelt - sehr unterschiedlich. Einige waren kräftig und saftig, andere klein und schmal, aber mit üppigen Blattwuchs, wieder andere schossen rasch empor und bildeten, früher als der Rest, Blüten aus. So mancher Gärtner hätte sich vielleicht darüber geärgert, die Schultern gezuckt, den Misswuchs weggeworfen und weitergemacht wie zuvor. Maria Thun aber wollte wissen, was dahintersteckt.
Die junge Frau war in der Nähe von Marburg auf einem Bauernhof aufgewachsen und hatte sich schon als Kind lebhaft für alle Vorgänge in der Natur interessiert. Als Krankenschwester hatte sie während des Krieges ihren Mann kennengelernt, den Anthroposophen Walter Thun, Lehrer für Kunst und Werken an einer Waldorfschule. Durch ihn kam sie mit den Schriften Rudolf Steiners in Berührung, und interessierte sich vor allem für den “Landwirtschaftlichen Kurs”, mit dem er 1924 die biologisch-dynamische Landwirtschaft begründet hatte.
Kernpunkt dieser speziellen ökologischen Anbaumethode ist die Auffassung, dass der Mutterboden lebendig ist, und alle landwirtschaftlichen Maßnahmen dazu dienen sollen, diese Lebendigkeit zu fördern. Dies geschieht vor allem durch die Einarbeitung von Kompost und Anwendung spezieller Präparate. Die wichtigsten sind “Hornmist”, der aus Rinderdung, und “Hornkiesel”, der aus Quarzmehl hergestellt wird, sowie 6 Präparate zur Verbesserung des Kompostes aus Schafgarbe, Kamille, Brennessel, Löwenzahn, Eichenrinde und Baldrian.
Es gibt weder chemische Spritzgifte, noch Mineraldünger. Zur Düngung werden nur Kompost und Pflanzenjauchen verwendet, zur Schädlingsbekämpfung Kräuteraufgüsse oder verbrannte und potenzierte Körper von Schadinsekten.
Vor allem aber sollen durch die Vitalisierung des Bodens die Abwehrkräfte der Pflanzen gestärkt werden, so dass sie sich selbst gegen Schädlinge wehren können. Bei Aussaat und Ernte werden kosmische Rhythmen berücksichtigt, insbesondere solche, die mit dem Mond zusammenhängen.
Maria Thun pachtete nun einen kleinen Garten in Marburg und begann, nach den Prinzipien Steiners, mit Kompost und den biologisch-dynamischen Präparaten zu arbeiten. Und eines Tages passierte dann die Sache mit den Radieschen, die sie wunderte und neugierig machte.
Maria Thun hatte die Samen an verschiedenen Tagen ausgesät, und so beschloss sie nachzuprüfen, ob der Aussaatzeitpunkt hier eine Rolle gespielt hatte. Tag für Tag säte sie ihre Radieschen, später dann auch andere Pflanzen wie zum Beispiel Spinat, Kohlrabi, Zwiebeln und Möhren, Erbsen und Bohnen, und kontrollierte sehr genau ihr Wachstum und ihre Qualität. Außerdem beobachtete sie gleichzeitig das Wetter und machte sich Notizen.
“Ich hatte mir einen Taschenkalender besorgt”, erzählt sie, “und darin habe ich dann alles aufgezeichnet. Wenn es Gewitter gab, habe ich zum Beispiel einen Blitz hingemalt, und wenn es regnete ein paar Wassertropfen, undsoweiter.”
Nach neun Jahren endlich war sie sich ihrer Beobachtungen so sicher, dass sie eine erste Veröffentlichung ihrer Versuchsergebnisse wagte. Und seit 1963 gibt sie jedes Jahr einen Kalender mit den günstigen Aussaattagen heraus, der mittlerweile in 26 Sprachen erscheint.
Was Maria Thun herausgefunden hatte, war ein deutlich erkennbarer Einfluss kosmischer Kräfte auf das Wachstum von Pflanzen, der vor allem mit der Stellung des Mondes vor den verschiedenen Sternbildern in Beziehung stand.
Als “Sternbilder” bezeichnet man verschiedene Muster von Fixsternen, vor denen die Sonne im Verlauf des Jahres vorbeizieht. Schon vor vielen tausend Jahren haben die Menschen zwölf solcher Sternbilder, die in der Ebene der Erdumlaufbahn (der sogenannten Ekliptik) liegen, voneinander unterschieden und mit Namen versehen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Die Gesamtheit dieser Sternbilder nannte man den “Tierkreis”. Auch der Mond durchwandert bei seinem Umlauf um die Erde diesen “Tierkreis”, und steht dabei jeweils einige Tage vor einem der verschiedenen Sternbilder.
Der “Tierkreis” der heutigen Astrologie beginnt mit dem Frühlingsäquinoktium am 20./21. März und teilt die Erdumlaufbahn in zwölf gleiche Teile von je 30°. Diese Abschnitte wurden zwar nach den verschiedenen Sternbildern benannt, aber sie entsprechen ihnen nicht ganz, da die Ausdehnung der Sternbilder teils länger (z. B. Jungfrau), teils kürzer (z. B. Krebs) als 30° ist. Außerdem verschiebt sich durch die Pendelbewegung der Erdachse die Position des Frühlingsäquinoktiums, und deshalb steht die Sonne an diesem Tag heute am Beginn des Sternbildes Wassermann. Und sie wandert während jenes Zeitraums, den die Astrologie dem Tierkreiszeichen Widder (21. März bis 19. April) zuordnet, durch das Sternbild der Fische. Die Sternbilder stimmen also nicht mehr mit den Tierkreiszeichen überein.
Maria Thun bezieht sich bei ihren Aussagen auf die tatsächlichen Sternbilder und nicht auf den astrologischen “Tierkreis”.
Die Sternbilder werden traditionell in Dreiergruppen den vier Elementen zugeordnet: Stier, Jungfrau und Steinbock der Erde, Krebs, Skorpion und Fische dem Wasser, Zwillinge, Waage und Wassermann der Luft, Widder, Löwe und Schütze dem Feuer.
Diesen vier Prinzipien gemäß vermittelt der Mond offenbar entsprechende Wachstumsimpulse an die Pflanzen: steht er vor den Erdzeichen, wird das Wurzelwachstum verstärkt, vor den Wasserzeichen vermehrt sich die Blattbildung, vor Luftzeichen wird die Bildung der Blüten und vor Feuerzeichen die Bildung der Früchte und Samen gefördert. Durch die Bodenbearbeitung werden diese kosmischen Impulse auf die Acker- oder Gartenerde übertragen.

 Aussaat und spätere Pflegearbeiten sollten also an den Tagen erfolgen, die dem jeweiligen Pflanzentyp entsprechen:
Aussaat und spätere Pflegearbeiten sollten also an den Tagen erfolgen, die dem jeweiligen Pflanzentyp entsprechen:
“Wurzeltage” (Mond vor Stier, Jungfrau, oder Steinbock) sind günstig beispielsweise für Radieschen, Möhren, Rote Beete, Knollensellerie, Kartoffeln und Zwiebeln.
“Blatttage” (Mond vor Krebs, Skorpion oder Fische) sind gut für die meisten Kohlarten (außer Brokkoli), Salat, Spinat, Petersilie, Gemüsefenchel und Rasen.
Zu den “Blütenttagen” (Mond vor Zwillinge, Waage oder Wassermann) passen Blumen, Blumenzwiebeln, viele Heilpflanzen und der Brokkoli.
Und die “Fruchttage” (Mond vor Widder, Löwe oder Schütze) schließlich fördern die Entwicklung von Bohnen, Erbsen, Mais, Tomate und Paprika, Kürbis und Gurken, sowie alle Getreide.
 Aussaat und Pflege zum richtigen oder falschen Zeitpunkt ergaben in Maria Thuns Versuchen Ertragsunterschiede von beispielsweise etwa 30 Prozent beim Spinat und teilweise bis zu 40 % bei Radieschen!
Aussaat und Pflege zum richtigen oder falschen Zeitpunkt ergaben in Maria Thuns Versuchen Ertragsunterschiede von beispielsweise etwa 30 Prozent beim Spinat und teilweise bis zu 40 % bei Radieschen!
Unterschiedliche Wirkungen zeigten sich auch im Zusammenhang mit den Mondphasen, dem Aufsteigen beziehungsweise Absteigen des Mondes, den Mondknoten sowie Erdnähe oder Erdferne unseres Trabanten.
Bei absteigendem Mond ziehen sich die Kräfte der Pflanze in die unterirdischen Teile zurück, diese Zeit ist gut für die Pflanzarbeiten, auch für das Stecken von Stecklingen.
Schneiden sollte man diese allerdings bei aufsteigendem Mond, denn dann strömen die Kräfte der Pflanzen in die oberirdischen Teile. Diese Periode ist auch günstig für die Ernte von Früchten.
Außerdem sollte man hier auch die entsprechenden Tage berücksichtigen, also Früchte an “Fruchttagen” ernten, Blattgemüse an “Blattagen”, und Blütenpflanzen an “Blütentagen”. Für die Ernte von Wurzelgemüse eignen sich demgemäß besonders gut die “Wurzeltage” bei absteigendem Mond.
Dass Aussaat bei Vollmond viel Ertrag bringt, allerdings auf Kosten der Qualität und Haltbarkeit, ist nicht erst seit den Versuchen von Maria Thun bekannt. Dies ist eine uralte Erkenntnis, die sich bereits in den Schriften des römischen Historikers Plinius wiederfindet.
1971 kauften die Thuns in Dexbach, nicht weit von Marburg entfernt einen kleinen Bauernhof, und 1976, als Walter Thun pensioniert wurde, zogen sie ganz dorthin. Maria Thun konnte nun auf einer viel größeren Fläche ihre Versuchsfelder einrichten, und ihr Sohn Matthias, gelernter Imkermeister, fand hier Platz für seine Bienenvölker - die übrigens auch von den kosmischen Rhythmen beeinflusst werden. Er arbeitet außerdem am Aussaatkalender mit und ist für die fotografische Dokumentation der Versuche zuständig.
Bald wurde auch ein Labor eingerichtet, um die Bestandteile der Pflanzen genauer analysieren zu können. Es wird heute von einem Enkel Maria Thuns geleitet, der promovierter Chemiker ist. Tatsächlich führten diese Analysen zu sehr interessanten Ergebnissen, beispielsweise fand man bei Möhren nach Behandlung mit dem biologisch-dynamischen Kieselpräparat einen um 6 % erhöhten Zuckeranteil. Auch die Anwendung solcher Präparate unterliegt dem Einfluss der kosmischen Rhythmen. Zum falschen Zeitpunkt eingesetzt, können sie eher schädlich als fördernd wirken.
Im Verlauf ihrer Arbeit entdeckte Maria Thun, dass auch die Stellung der Planeten zueinander von Bedeutung war, und teilweise sogar stärker wirkte, als der Einfluss des Mondes. Allerdings wurde diese Wirkung bei künstlicher Bewässerung verwischt, teilweise sogar ausgelöscht, und die Mondwirkung dominierte wieder.
Schon vorher hatte man festgestellt, dass die Bodenbearbeitung an den verschiedenen Tagen den Stoffwechsel der Pflanzen veränderte. So zeigte zum Beispiel Spinat, der an “Wurzeltagen” (Mond vor Erdzeichen) gehackt wurde, einen enorm erhöhten Nitratgehalt.
Andere Pflanzen reagierten ähnlich. Die Einflüsse der Planeten wiesen in die gleiche Richtung. Bei Oppositionen (180° Winkel) des Mars zu anderen Planeten nehmen die Pflanzen zum Beispiel vermehrt Eisen auf, und bei Merkuroppositionen reichern sie sich mit Kupfer an.
Mit dieser Erfahrung geriet Maria Thun allerdings in Konflikt mit anthroposophischen Wissenschaftlern, die traditionell das Kupfer dem Planeten Venus zuordnen. “Einige haben danach nicht mehr mit mir gesprochen”, erzählt Maria Thun. “Aber was sollte ich machen? Ich kann ja meine Ergebnisse nicht verleugnen, nur weil sie nicht mit bestimmten Meinungen zusammenpassen.”
Auch bei ihren Beobachtungen der Wirkung von Planeten auf das Wetter fand Maria Thun Widersprüche zur traditionellen Auffassungen. Aufgrund ihrer Erfahrungen ordnete sie Mars, Mond und Neptun dem Element Wasser zu, Jupiter Venus und Uranus der Luft, Saturn Merkur und Pluto der Wärme und die Sonne der Erde. Mars aber gilt gemeinhin als Vertreter des “Trockenen”, der Saturn gilt als “kalt” und die Sonne als “feurig”.
Heute sieht Maria Thun auf Grund ihrer Erfahrungen einen klaren Zusammenhang zwischen der Stellung von Planeten vor bestimmten Sternbildern und dem Wetter.
“Zieht ein Wärmeplanet wie Merkur vor dem Sternbild Widder vorbei, dann verstärkt sich seine Wirkung”, so schreibt sie beispielsweise. Und auch: “Ziehen der Mond oder Planeten, die über das Element Wasser wirken, vor eine Region des Tierkreises, die sich ebenfalls über das Wasser bemerkbar macht, dann muss man bei uns mit Niederschlagsperioden rechnen.”
Auf solchen Zuordnungen beruhte ihre - sehr zutreffende - Prognose für das Wetter im Jahr 2003 und den besonders warmen Sommer. “Für das Jahr 2004 verändert sich diese Situation schon wieder”, schreibt sie allerdings in der neuen Ausgabe ihres Aussaatkalenders, und meint, “dass die Wärmeepochen Merkurs sehr verkürzt und mehr Niederschläge zu erwarten sind.” Immerhin bleibt er um die Jahresmitte einige Zeit im Löwen “und wird uns dann den Sommer gründlich erwärmen.”
Ihre Prognosen seien zu etwa 80 % richtig gewesen, meint Maria Thun rückblickend. Sehr viele unterschiedliche Faktoren sind am Wetter und am Pflanzenwachstum beteiligt, und sie glaubt keineswegs, schon alle zu kennen. Ihre Neugierde ist immer noch wach, und ihr Arbeitseifer ungebrochen. Sie hält weiterhin Vorträge und Kurse und berät zahlreiche Biohöfe, unter anderem auch die Sekhem-Farm in Ägypten, die gerade den “Alternativen Nobelpreis” bekommen hat. Und sie fühlt sich immer noch wohl bei ihrer Arbeit.
Ein chinesischer Weiser schrieb vor vielen tausend Jahren: “Wenn du einen Tag glücklich sein willst, dann betrinke dich. Willst du ein Jahr glücklich sein, dann heirate. Wenn du aber ein Leben lang glücklich sein willst, werde Gärtner.” Mag sie auch manchem etwas übertrieben erscheinen - für Maria Thun jedenfalls trifft diese Weisheit haargenau zu.
Adresse:
M. Thun-Verlag
Rainfeldstr.16
D-35216 Biedenkopf / Dexbach
Tel.: (06461) 3227 Fax: (06461) 4714 e-mail: Thunverlag@Aussaattage.de
Bücher von Maria Thun:
“Aussaattage ....”
“Das Handbuch zu den Aussaattagen”
“Milch und Milchverarbeitung”
“Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit”
“Hinweise aus der Konstellationsforschung”
“Bäume, Hölzer und Planeten”
“Tausendgulden- und Hellerkräuter” (alle im Thun-Verlag)
“Erfahrungen für den Garten” (Franckh-Kosmos-Verlag)
Zurück zum Inhalt
© Reinhard Eichelbeck
Erschien in etwas veränderter Form in "BIO" 5 / 2006
Vieles wurde vollmundig versprochen: neue Medikamente für unheilbare Krankheiten, bessere und gesündere Nahrungsmittel, eine umweltfreundlichere Landwirtschaft mit weniger Pestizideinsatz und höherem Ertrag, ein Ende des Hungers in der Welt und Babys nach Maß.
Eingelöst hat die Gentechnologie ihre Versprechungen bislang nicht. Stattdessen treten die Probleme und Risiken immer deutlicher zutage. Versuchstiere zeigten nach Fütterungsversuchen mit gentechnisch veränderten Pflanzen schwere Organschäden, zahlreiche Menschen reagierten allergisch, und einige bezahlten ihre Begegnung mit der Gentechnik sogar mit dem Leben.
Was bringt uns das Ganze, und was kostet es? Wenn man Risiken und Nutzen ehrlich gegeneinander abwägt: lohnt es sich dann überhaupt noch?
Die Gentech-Propagandisten verbreiten immer wieder eine Reihe von Unwahrheiten und Halbwahrheiten, die ich der Einfachheit halber hier vorab einmal aufzählen möchte:
- „Die Gentechniker wissen, was sie tun.“ Falsch! Die Gentechniker schießen Fremdgene in eine Zelle, wissen aber weder, wo sie landen, noch was sie dabei alles bewirken, und welche Konsequenzen das auf lange Sicht hat.
- „Die Ängste vor der Gentechnologie sind unbegründet, weil nur wissenschaftlich gesicherte Genveränderungen zugelassen werden.“ Falsch! Über wesentliche Aspekte der Genveränderung gibt es kein gesichertes Wissen, sondern nur Vermutungen.
- „Lebensmittel aus geprüften, gentechnisch veränderten Kulturpflanzen sind sicher für Mensch und Tier. Sie sind keine Gefahr für die Umwelt.“ Falsch! Das kann niemand beurteilen, weil es nicht gründlich genug überprüft wurde. Und verschiedene, im Folgenden beschriebene Katastrophen und unanhängige Untersuchungen beweisen das Gegenteil!
- "Landwirtschaft mit gentechnisch veränderten Pflanzen und ökologische Landwirtschaft bilden keine unüberbrückbaren Gegensätze." Die Kontamination konventioneller oder ökologischer Pflanzen durch Gentechpollen ist in der Praxis unvermeidbar. Und was sich daraus ergibt zeigt sehr drastisch das Beispiel des kanadischen Bauern Percy Schmeiser (siehe: KursKontakte)!
- „Durch die Gentechnologie wird die Ausbringung von Pestiziden vermindert.“ Falsch! Auf lange Sicht werden durch Resistenzbildungen bald wieder genauso viel oder sogar noch mehr Pestizide verwendet (siehe: Schweisfurth-Stiftung und Greenpeace).
- „Nicht nur große Unternehmen, sondern vor allem kleine Bauern profitieren von den gentechnisch veränderten Kulturpflanzen. Die Technologie trägt dazu bei, dass die Armut der Kleinbauern in den Entwicklungsländern abgemildert wird.“ Falsch! Die Praxis beweist das Gegenteil (siehe: Greenpeace)!
- „Gentechnisch veränderte Kulturpflanzen können einen wesentlichen Beitrag zu einer quantitativ und qualitativ besseren Versorgung mit Lebensmitteln leisten.“ Das mag theoretisch möglich sein – in der Praxis steht der Beweis dafür noch aus.
Gentechnologie - Horror, Hoffnung oder Hirngespinst?
Was kann die Gentechnologie wirklich?
Am 13. März dieses Jahres nahmen sechs gesunde junge Männer in einer Londoner Klinik während eines Medikamentenversuches wenige Milligramm eines neuen Arzneimittels mit dem Namen TGN 1412 ein. Dieser Stoff, ein sogenannter „monoklonaler Antikörper“, war von einer deutschen Biotechnologie-Firma entwickelt worden und sollte bei Leukämie oder Rheuma eingesetzt werden, um „ein zu stark oder zu schwach reagierendes Immunsystem therapeutisch auszubalancieren.“
Ausführliche Tierversuche mit Kaninchen und Affen, die dem Test vorausgingen, hatten keinerlei Probleme erkennen lassen. Außerdem verwendete man im Test eine Dosis, die um den Faktor 160 geringer war als die, mit der man in den Tierversuchen gearbeitet hatte. Nichts war ungewöhnlich an diesem Test, alles im Rahmen des Üblichen.
Dann aber geschah etwas, das niemand erwartet hatte. Ein Augenzeuge beschrieb es so: „Der erste Proband klagte über schwerste Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Fieber. Er riss sich sein Hemd vom Leib und schrie, er verbrenne. Sein Nebenmann fiel vor Schmerzen immer wieder in Ohnmacht. Alle kotzten.“
Die sechs jungen Männer kamen sofort auf die Intensivstation, wo die Ärzte um ihr Leben kämpften. Das Medikament hatte offenbar bei allen eine entzündliche Schockreaktion ausgelöst, die zu massiven Schwellungen von Kopf und Gehirn führte, sowie zum Versagen mehrerer Organe. Erst nach Tagen konnten die Männer gerettet werden, bei dem am schlimmsten Betroffenen, der lange im Koma lag, hatten sich Füsse und Fingerspitzen schwarz gefärbt und waren abgestorben.
Was hier geschehen war sei, so die Erfinder des Mittels, „mechanistisch nicht erklärbar“. In den Tierversuchen war keine der hier aufgetretenen Störungen auch nur ansatzweise erkennbar gewesen, sie kamen „völlig unerwartet“.
Das Drama machte Schlagzeilen und ging, mit den entsprechenden dramatischen Fotos versehen, durch die Presse. Was die Mehrzahl der Zeitungen nicht erwähnte, war die Tatsache, dass der fatale „monoklonale Antikörper“ ursprünglich aus einer Ratte stammte, und mittels Gentechnik „humanisiert“ wurde, was „heute ein Standardverfahren in der Industrie ist“ – so die FAZ.
Wieder einmal zeigte sich, dass Tierversuche keine verlässlichen Rückschlüsse erlauben – auch Contergan und LSD hatten im Tierversuch keine Auffälligkeiten gezeigt. Wieder einmal war ein Produkt der Gentechnologie Auslöser einer Katastrophe, und wieder einmal wurde dies nur ganz am Rande, wenn überhaupt, zur Kenntnis genommen.
Bereits 1989 hatte ein Gentech-Produkt in den USA vergleichbare Störungen ausgelöst, allerdings in viel größerem Ausmaß. Die Zahl der Erkrankten wurde auf 5000 bis 10000 geschätzt, die Zahl der Todesopfer auf nahezu vierzig. Spätere Untersuchungen kamen sogar zu der Annahme, dass es mehr als 80 waren.
Symptome der Erkrankung waren geschwollene Gliedmaßen, Lähmungen, Ausschläge, Gleichgewichtsstörungen, Muskelschmerzen und -krämpfe, und eine auf das zum Teil Tausendfache erhöhte Anzahl einer bestimmten Art weißer Blutkörperchen, den sogenannten Eosinophilen. Dementsprechend nannte man das Phänomen Eosinophilen-Myalgie-Syndrom, kurz: EMS.
Nachforschungen der durch die bizarre Symptomatik alarmierten Ärzte ergaben, dass alle Erkrankten L-Tryptophan-Präparate eingenommen hatten. L-Tryptophan ist eine der sogenannten essentiellen Aminosäuren, die vom Körper nicht selbst gebildet werden und mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Sie ist an der Bildung von Serotonin beteiligt, einem körpereigenen Botenstoff, der dazu beiträgt, dass wir uns wohl fühlen, entspannen und besser schlafen können.
Als frei verkäufliche Nahrungsergänzung waren verschiedene Sorten von L-Tryptophan in den USA auf dem Markt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass nur eines der verfügbaren Präparate mit der Krankheit in Verbindung gebracht werden konnte: es war von Showa Denko, dem viertgrößten Chemiekonzern Japans hergestellt worden, und hatte seinerzeit in den USA den größten Marktanteil.
Showa Denko hatte gentechnisch veränderte Bakterienstämme zur Herstellung seines L-Tryptophans verwendet, die doppelt soviel L-Tryptophan erzeugten, wie die nicht veränderten Bakterien. Allerdings erzeugten diese Bakterien auch mehrere stoffliche Verunreinigungen, die zwar winzig waren, weniger als 0,1 %, aber von den untersuchenden Wissenschaftlern für die Erkrankung verantwortlich gemacht wurden.
Die Opfer reichten Klage ein, und Showa Denko einigte sich mit ihnen in einem außergerichtlichen Verfahren, wobei der Konzern insgesamt mehr als zwei Milliarden Dollar an Entschädigungen zahlte. Die gentechnisch veränderten Bakterienstämme wurden vernichtet, und es wurde nicht weiter in der Öffentlichkeit diskutiert, dass fehlgeleitete Gentechnologie die Ursache des Desasters war.
Dass die Ursache von EMS entdeckt wurde, lag an der ungewöhnlichen Symptomatik, die die Ärzte zu gründlicheren Nachforschungen veranlasste. Hätte die L-Tryptophan-Verunreinigung nur einfache und bekannte Krankheitsbilder ausgelöst, Allergien zum Beispiel oder Asthma, wäre man vermutlich gar nicht auf die Idee gekommen, nach einer besonderen Ursache zu suchen, oder gar das Showa-Denko-Präparat zu verdächtigen – denn es hatte ja, wegen der winzigen Menge an Verunreinigungen, die behördlichen Reinheitskriterien problemlos erfüllt.
Ein erheblicher Teil unserer Arzneimittel wird heute mit gentechnischen Verfahren hergestellt. In Deutschland sind bereits mehr als 60 derartige Medikamente zugelassen, darunter Humaninsulin, Wachstumshormone oder Impfstoffe, gegen Hepatitis B zum Beispiel oder Keuchhusten. Auch Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine oder Geschmacksverstärker stammen inzwischen weitgehend aus der Gentechnologie, werden mit Hilfe genetisch aufgerüsteter Bakterien hergestellt. Theoretisch könnten sie alle winzige Mengen problematischer Stoffe enthalten, denn niemand kann garantieren, dass die Bakterien wirklich nur das produzieren, was ihre Erzeuger wollen.
Woran liegt das? Zum einen an den Verfahren, die die Gentechnik anwendet, um Gene zu übertragen, zum anderen an der Art und Weise, wie die Organismen mit ihren Genen umgehen.
Alle Lebewesen auf diesem Planeten enthalten in ihren Zellen die „Erbinformation“ in Form eines sehr langen, strickleiterähnlichen Kettenmoleküls, der sogenannten Desoxyribonucleinsäure, kurz DNS. Einzelne Abschnitte auf diesem Molekül enthalten Bauanleitungen für Proteine, für körpereigene Baustoffe und Botenstoffe, für Arbeits- und Steuerungsmoleküle. Diese Abschnitte nennt man „Gene“, und lange Zeit galt es als sicher, dass ein Gen jeweils nur für ein ganz bestimmtes Protein verantwortlich ist. Inzwischen weiß man, dass mit einem Gen auch verschiedene Proteine produziert werden können. Zahlreiche Gene enthalten auch Einschübe, die nicht zum Proteinbauplan gehören, und von den zelleigenen Arbeitsmolekülen herausgetrennt werden, bevor der Bauplan umgesetzt wird. Woher die Arbeitsmoleküle wissen, was sie da herausschneiden müssen, ist der Wissenschaft bislang noch ein Rätsel. Nichtsdestoweniger muss dieser Prozess sehr präzise sein, damit ein funktionsfähiges Protein entsteht.
Ursprünglich war man auch der Meinung, dass die DNS eine feste Struktur hat, die sich nicht verändert. Inzwischen weiß man, dass sie von den Arbeitsmolekülen der Zelle ständig umgebaut wird. Gene werden herausgeschnitten und an anderer Stelle wieder eingefügt, auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Die Amerikaner haben dafür den Ausdruck „fluid genom“ erfunden: „flüssige Erbinformation“.
Es hat sich auch herausgestellt, dass nur ein kleiner Teil der DNS, weniger als 5 %, aus Genen besteht. Was der überwiegende Rest von über 95 % für eine Funktion hat, ist noch fraglich. Auch die Frage der Organisation all dieser chemischen Abläufe in der Zelle ist noch nicht geklärt.
Diese Unkenntnis grundlegender Prinzipien macht die Risiken der Gentechnologie derzeit schlicht unkalkulierbar. Niemand kann garantieren, dass ein eingeschleustes Gen an der Stelle bleibt wo es ist, dass es so bleibt, wie es ist, dass es sich nicht verändert oder andere Gene beinflusst, und damit möglicherweise zu einer Produktion von fehlerhaften oder toxischen Proteinen führt, die die oben beschriebenen Auswirkungen haben können.
Um fremde Gene in Organismen einzuschleusen, benutzt die Gentechnik entweder Viren oder Bakterien, die umgebaut und mit den entsprechenden Genen „beladen“ werden, die sie dann in die Zellen des Zielorganismus transportieren, oder eine Art „Schrotschusstechnik“. Dabei werden die Gene auf winzige Goldpartikel aufgebracht, die dann in eine Patrone gefüllt und mit einer Pulverladung in die Zielzellen hineingeschossen werden. Ob das neue Gen dann in der DNS landet, und wo es dort landet, bleibt dem Zufall überlassen. Nur ein winziger Teil der Zellen nimmt das neue Gen auf, und um herauszufinden, welche das sind, verbindet man das neue Gen mit einem weiteren Gen, das eine Antibiotikaresistenz hervorruft. Die Zellen werden dann alle einem starken Antibiotikum ausgesetzt, und bei denjenigen, die diese Prozedur überleben, weiß man, dass sie das neue Gen aufgenommen haben.
Da die Zelle aber normalerweise ein fremdes Gen nicht erkennt und in Protein umsetzt, hängt man an das Gen auch noch eine „Einschaltsequenz“ an, die dazu führt, dass das Gen ständig „eingeschaltet“ ist und das gewünschte Protein – sei es Medikament oder Giftstoff – auch produziert wird. Diese „Schalter“ bestehen aus umgebauten Bestandteilen verschiedener Viren. Bei Pflanzen verwendet man gern das Blumenkohl-Mosaik-Virus, bei einem genetisch veränderten Fisch – der allerdings noch nicht zugelassen ist – hat man Teile dreier Viren zusammengebastelt, von denen einer bei Mäusen Leukämie hervorruft, der zweite Sarkome (eine bösartige Geschwulst des Bindegewebes) bei Hühnern und das dritte Mundverletzungen bei Rindern, Schweinen und Menschen. Und wenn diese Fische eines Tage in den Handel kommen sollten, landet diese seltsame Mischung auf dem Teller des Verbrauchers - denn die DNS ist ein stabiles Molekül, das auch Kochen übersteht. Guten Appetit, kann man da nur sagen.
Angesichts dieser groben und ungezielten Technik kann niemand wissen, wo das neue Gen in der DNS des Zielorganismus landet, welche anderen Gene es beeinflusst oder in ihrer Funktion stört, und welche Konsequenzen das hat. Außerdem wird, wie gesagt, die DNS ja ständig umgebaut, und auch dadurch kann das neue Gen in unkontrollierbarer Weise verändert werden.
Jeder gentechnisch veränderte Organismus (kurz: GVO) müsste also gründlichst und fortlaufend untersucht und auf mögliche unerwünschte Proteine kontrolliert werden. Solche Untersuchungen finden aber nicht statt mit der Begründung, die GVO’s seien „substanziell äquivalent“, das heißt, sie unterscheiden sich stofflich nicht von den unveränderten Ursprungsorganismen. Ob das wirklich so ist, könnte man aber erst durch die Untersuchungen herausfinden, die man mit dieser Definition vermeidet.
Wo tatsächlich von unabhängigen Wissenschaftlern solche Untersuchungen durchgeführt wurden, zeigte sich, dass manche GVO’s sich erheblich von ihrem konventionellen Gegenstück unterscheiden. Gensoja der Firma „Monsanto“, das gegen das Unkrautvernichtungsmittel „Roundup“ resistent gemacht wurde, hatte zum Beispiel weniger Isoflavone, weniger Protein, sowie geringere Mengen einer Fettsäure und einer essentiellen Aminosäure, als konventionelles Soja. Und eine genetisch veränderte Rapssorte wurde von „Monsanto“ 1997 aus dem Verkehr gezogen, weil eine Überprüfung ergeben hatte, dass sie ein „unerwartetes“ Gen enthielt.
Aber nicht nur die möglichen unvorhersehbaren Veränderungen durch die Gentransplatationen sind problematisch, sondern auch diese Gene selbst. So hat man in Mais beispielsweise das Gen eines Bodenbakteriums eingeschleust, das den Bauplan für ein „BT-Toxin“ genanntes Gift enthält. Dieses Gift wird dann permanent in allen Teilen der Pflanze erzeugt und soll den Hauptschädling der Maiskulturen töten – und nur ihn allein: die Raupe des Maiszünslers.
Erstes Aufsehen erregten Experimente in den USA, die zeigten, dass auch Raupen des Monarch-Falters starben, die man mit Pollen von Genmais gefüttert hatte. Da dieser Schmetterling in Nordamerika sehr populär ist, gab es ein entsprechendes Medienecho. „Monsanto“ wiegelte ab mit der Begründung, Mais sei nicht die normale Nahrungspflanze der Raupen und außerdem würde der Mais erst blühen, wenn die Raupen schon ausgewachsen sind.
Tatsache aber bleibt, dass der Maispollen auch für sogenannte „Nichtzielorganismen“ tödlich sein kann. Spätere Experimente zeigten, dass auch die natürliche Feinde des Maiszünslers, die Florfliegenlarven, eine dramatisch höhere Sterblichkeitsrate zeigten, wenn sie die vom „BT-Toxin“ vergifteten Maiszünslerraupen gefressen hatten. Und nicht zuletzt kam es dann in den USA auch zu einer Nahrungsmittelkatastrophe im Zusammenhang mit BT-Mais.
Der „Star-Link“-Mais der Firma „Aventis“ produzierte eine Form des „BT-Toxins“, die besonders widerstandsfähig gegen Hitze und Verdauungssäfte war, und damit tödlicher für die Insekten, als die anderen Varianten. Aus Sicherheitsgründen war er nicht für den menschlichen Verzehr zugelassen, sondern nur für industrielle Zwecke und als Tierfutter. Obwohl er auf weniger als einem Prozent der Maisanbaufläche kultiviert wurde, gelangte der „Star-Link“-Mais dennoch durch Vermischung in den Silos unter jene Maissorten, die für Nahrungsmittel verwendet wurden, für Tortillas, Tacos, Cornflakes und andere Produkte, die Mais enthielten. Die Folgen waren dramatisch.
Zahlreiche Menschen, die diese Produkte gegessen hatten, mussten ins Krankenhaus gebracht werden, weil sie einen sogenannten anaphylaktischen Schock erlitten, eine schwere allergische Reaktion des Gesamtorganismus. Mehr als 300 Produkte wurden aus den Läden zurückgerufen, die amerikanischen Maisexporte und Preise sackten in den Keller, und eine Fülle von Firmen und Einzelpersonen verklagte „Aventis“ auf Schadensersatz. Am Ende hat die „Star-Link“-Katastrophe den Konzern rund eine Milliarde Dollar gekostet.
Das „BT-Toxin“, das im „Star-Link“-Mais wirksam war, unterscheidet sich nur geringfügig von den anderen Formen des „BT-Toxins“, die sich nicht nur in Mais-, sondern auch in Baumwoll- und Kartoffelpflanzen finden. Auch wenn sie etwas weniger giftig sind, sind sie doch keineswegs unbedenklich. Norwegische Ökologen haben festgestellt, dass mindestens 39 Personen, die auf den Philippinen neben großen BT-Maisplantagen leben, während des Pollenfluges unter Atemstörungen, Hautausschlägen und Fieber litten. Blutuntersuchungen wiesen auf eine Immunreaktion gegen die Maispollen hin. Die Ergebnisse seien noch nicht endgültig, heißt es. Aber es ist nicht schwer sich vorzustellen, dass Menschen, die schon auf normale Pollen allergisch reagieren, mit dem giftigen Pollen noch erheblich größere Schwierigkeiten haben werden.
Der „Star-Link“-Mais wurde aus dem Verkehr gezogen, aber aus der Nahrungskette ist er trotzdem nicht völlig verschwunden. Durch Pollenflug hat er seine Gene auf andere Maissorten übertragen, und pflanzt sich mit ihnen zusammen fort. Da er durch seine größere Giftigkeit einen Selektionsvorteil hat, wird er sich vielleicht sogar im Lauf der Zeit besser vermehren, als die anderen Sorten. Das amerikanische Landwirtschaftsministerium, das 288 Saatgutfirmen überprüfte, entdeckte bei immerhin 71 davon in deren Mais noch „Star-Link“-Körner.
Ihre unkontrollierbare Ausbreitung auf verwandte Arten durch Pollenflug ist eines der Hauptprobleme beim Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen. Die Gentechlobby behauptet zwar immer wieder, das Problem sei „durch einfache Maßnahmen wie die Einhaltung von Mindestabständen zwischen den Feldern“ zu lösen, aber das ist nur PR-Geschwätz. Es gibt keine sicheren Abstände. Niemand kann dem Pollen vorschreiben, wie weit er zu fliegen hat. Ein Sturm treibt ihn möglicherweise über hunderte von Kilometern hinweg.
Staub und Mikroorganismen aus der Sahara wurden bis nach Brasilien geweht, und haben dort bei Menschen allergische Reaktionen hervorgerufen. Wenn offenbar nicht einmal die Breite des Atlantiks als Sicherheitsabstand ausreicht – wie will man dann „Mindestabstände“ definieren? Wie will man den giftigen Gentechpollen daran hindern, „auf den Flügeln des Windes“ um die ganze Welt zu reisen – oder doch zumindest bis ins übernächste Dorf? Auch Bienen kommen als Pollentransporteure in Frage, und deren Reichweite kann mehrere Dutzend Kilometer betragen. Raps lieben sie besonders, und man hat in kanadischem Honig Spuren von gentechnisch verändertem Rapspollen gefunden.
Eine Übertragung von GVO-Genen auf konventionell oder ökologisch angebaute Arten ist ebenso unvermeidbar wie unumkehrbar – und proportional zur angebauten Fläche. Aus Kanada wird berichtet, dass es bereits keinen konventionellen Raps mehr gibt, der gänzlich von GVO-Raps frei wäre. Und dort, wo man ihn nicht haben will, auf Getreidefeldern beispielsweise, ist der herbizidresistente Raps zu einem Superunkraut geworden, das man selbst mit massivem Gifteinsatz kaum noch in den Griff bekommt.
Die Pestizide und ihre Rückstände auf Gemüse und Obst sind schon in der konventionellen Landwirtschaft ein schwerwiegendes Problem – die Gentechnik baut die Gifte nun auch noch direkt in die Pflanzen ein, damit wir sie nun noch sicherer mitessen können. Bauern berichteten, dass Kühe, Schweine, ja sogar Eichhörnchen und Mäuse den BT-Mais nicht anrührten, wenn man ihnen gleichzeitig konventionellen Mais anbot. Und Tiere wissen gewöhnlich instinktiv, welche Nahrung ihnen bekommt, und welche nicht.
Die Gentechkonzerne versichern indessen unentwegt, dass ihre Produkte harmlos sind, „safe and nutritious“, wie es auf einer Internetseite von „Monsanto“ heißt: sicher und nahrhaft. Einen ernstzunehmenden Nachweis für diese Behauptung allerdings bleiben sie schuldig. Die British Medical Association bemängelte: „Es hat bisher keine belastbaren und gründlichen Untersuchungen über die potentiell negativen Auswirkungen von Gennahrung auf die menschliche Gesundheit gegeben.“
Gentechbefürworter wie Nestlé-Cef Brabeck oder der amerikanische Handelsbeauftragte meinen: „Millionen von Amerikanern essen seit Jahren täglich Genfood, und keine einzige gesundheitliche Folge ist belegt.“ Abgesehen von den oben genannten Beispielen zeigt aber auch eine einfache Betrachtung der Gesundheitsentwicklung ein anderes Bild. Parallel zur Einführung von „Genfood“ hat sich die Zahl ernährungsbedingter Krankheiten in den USA binnen sieben Jahren verdoppelt. Die Fettleibigkeit nahm rapide zu, Diabetes-Erkrankungen stiegen um 33 Prozent und auch Krebserkrankungen des Lymphsystems haben deutlich zugenommen.
„Es gibt viele Berichte über einen Anstieg von Allergien - beispielsweise haben in Großbritannien die Soja-Allergien um 50 Prozent zugenommen, seit dort Gensoja importiert wird“, erklärte Michael Meacher, ehemals englische Umweltminister, der wegen seiner kritischen Haltung zur Gentechnik entlassen wurde.
Eindeutig beweisen lässt sich ein Zusammenhang allerdings nicht – denn durch die fehlende Kennzeichnung von „Genfood“, die von der Industrie in den USA seit Jahren verhindert wird, lässt sich nicht nachprüfen, wer welche Nahrung zu sich genommen hat, und in welchem Umfang.
Untersuchungen die die Gentech-Industrie selbst unternommen hat, waren bewusst so angelegt, dass die Risikofaktoren abgeschwächt wurden. Aventis kochte seinen „Star-Link“-Mais viermal länger als üblich, bevor seine Proteine überprüft wurden, und er ersetzte das „BT-Toxin“ für die Untersuchung durch ein anderes, das direkt von Bakterien gewonnen wurde.
Monsanto hat bei Fütterungsversuchen eine Mischung verwendet, die nur zu einem Zehntel aus dem Gensoja bestand, dessen Wirkung untersucht werden sollte. Und um zu zeigen, dass sie keine intakten Moleküle ihres Rinderwachstumshormons mehr enthält, erhitzten sie die Milch der behandelten Kühe 120 mal so lange wie sonst bei der Pasteurisierung üblich.
Abgesehen davon, dass sie durch derartige Manipulationen wertlos werden, zeigen diese Versuche aber auch, dass die Firmen ihren eigenen Produkten offenbar doch so sehr misstrauen, dass sie vor einem ernstzunehmenden Risikotest zurückschrecken.
Eine der wenigen unabhängigen Untersuchungen, die es hier gibt, wurde 1998 von Professor Arpad Pusztai am Rowett Institute in Schottland durchgeführt. Er fütterte eine Gruppe von Ratten mit gentechnisch veränderten Kartoffeln, und fand bereits nach 10 Tagen bedenkliche Effekte: Gewebevergrößerungen in Bauchspeicheldrüse und Darm, Wucherungen von Magenzellen, kleinere und schlechter entwickelte Gehirne, Hoden und Lebern als die Ratten der Kontrollgruppe. Als er mit diesen alarmierenden Ergebnissen an die Öffentlichkeit ging, wurde er entlassen, diffamiert und gedemütigt. Seine Arbeit wurde als unvollständig, falsch und fehlerhaft bezeichnet. Erst Jahre später wurde er von Kollegen, die seine Versuche überprüft und als seriös eingestuft hatten, rehabilitiert.
Und kürzlich erst haben australische Forscher ihre Experimente mit gentechnisch veränderten Erbsen abgebrochen, weil Versuchsmäuse, die sie mit den Erbsen gefüttert hatten, Lungenkrankheiten bekamen. Der wissenschaftliche Leiter der Versuche meinte, es sei nicht auszuschließen, dass „so etwas auch passieren kann, wenn Menschen diese Erbsen essen.“
Obwohl die Risiken der Gentechnologie immer deutlicher werden, meinte ein Wissenschaftler wie Professor Ernst-Ludwig Winnacker, Genetiker und Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft im SPIEGEL: „Übriggeblieben sind für mich von der ganzen Risikodiskussion einzig eine Reihe von ethischen Fragen, die dort ansetzen, wo das menschliche Erbgut selbst zum Gegenstand gentechnischer Anwendungen wird.“
Um den Wert dieser „wissenschaftlichen“ Aussage richtig bewerten zu können, muss man allerdings wissen, dass Professor Winnacker im Aufsichtsrat von Firmen sitzt, die sehr aktiv in der Gentechnik tätig sind, zum Beispiel dem Bayer-Konzern.
Professor Winnacker sollte sich in der Tat mehr Sorgen um unsere Gesundheit machen, als um unser „Erbgut“, denn das ist vorläufig noch nicht ernsthaft in Gefahr. Zwar hat man die menschliche DNS mit großem Aufwand katalogisiert und die Wirkung etlicher Gene entschlüsselt, aber diese Forschungen haben wesentlich mehr Fragen aufgeworfen, als beantwortet.
Die Vorstellung, menschliche Gene verändern oder austauschen zu können, bleibt angesichts der immensen damit verbundenen Schwierigkeiten bis auf weiteres im Bereich der „science fiction“ und nicht der „science“.
Die Hoffnung, Erbkrankheiten gentechnisch heilen zu können hat sich bislang als trügerisch erwiesen. „Die Hindernisse sind gewaltiger, als viele von uns erwartet haben“, meinte Professor Theodore Friedman aus San Diego, einer der Pioniere der neuen „Genmedizin“.
Von großem Presseecho war die Entdeckung zweier „Brustkrebsgene“ begleitet. Aber die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau mit diesen Genen Brustkrebs bekommt, sank bald von „fast sicher“ auf „möglicherweise 10 Prozent“. Mit anderen Worten: 90 Prozent der Frauen mit diesen Genen bekommen keinen Brustkrebs. Andererseits zeigte eine Untersuchung an einigen Hundert Tumorpatientinnen, dass nur weniger als ein Zehntel die besagten Brustkrebsgene besaß. Mit anderen Worten: 90 Prozent der Frauen bekamen ihren Krebs ohne diese Gene.
Eine genetische Auffälligkeit bei einer Reihe von miteinander verwandten Homosexuellen wurde zu einem „Schwulengen“ hochstilisiert. Nichtsdestoweniger waren die meisten Homosexuellen auch ohne dieses Gen schwul, und andere Träger dieses Gens waren es nicht.
Einige Fälle von Hypercholesterinämie gingen mit einer bestimmten Genmutation einher. Aber die Mehrzahl der Fälle hat ihre Ursache in einer allgemeinen Anfälligkeit, verbunden mit der entsprechenden Lebensführung. Tatsächlich ist nach aller Erfahrung die Lebensführung viel entscheidender für das Entstehen einer Krankheit, als irgendwelche Gene.
Die Entdeckung eines „Gens für Fettleibigkeit“ wurde ebenfalls bejubelt, bis sich herausstellte, dass die Mehrzahl der Amerikaner auch ohne dieses Gen übergewichtig wurde.
Es wurde von „Aggressivitätsgenen“ gefabelt und von „Trunksuchtsgenen“. Jede Gelegenheit, die Verantwortung für das eigene Leben auf irgendwelche ominösen Gene abzuschieben, wurde genutzt.
James Watson, Leiter der „Human Genome Organisation“, meinte: „Einst lebten wir in dem Glauben, unser Schicksal läge in den Sternen. Jetzt wissen wir, das unsere Gene für unser Schicksal maßgebend sind.“ Beides ist falsch. Unser Schicksal liegt weder in den Sternen, noch in den Genen. Es liegt in uns selbst, und in dem, was wir aus uns und unserem Leben machen.
Ein anderes uneingelöstes Versprechen der Gentechnologen liegt in der Behauptung, man werde Nahrungsmittel von besserer Qualität erzeugen. Bislang ist davon nichts zu bemerken. Der Versuch, Sojabohnen mit einem Gen aus der Paranuss zu versehen, um ihr Proteinspektrum aufzuwerten, endete mit der Erkenntnis, dass dieses Soja bei Menschen mit Paranussallergie tödliche Folgen haben kann. Es kam nicht in den Handel.
Mit großem Werbeaufwand feierte der Biotechkonzern „Syngenta“ seine Schöpfung „Golden Rice“, der helfen sollte, „Blindheit und Infektionen bei Millionen von Kindern zu verhindern, die unter Vitamin-A-Mangel leiden.“ Durch die Übertragung von Narzissengenen hatte man einen Reis erzeugt, der sein eigenes Beta-Carotin herstellt, eine Vorform von Vitamin A.
Eine Untersuchung von Greenpeace ergab dann aber, dass ein Kind täglich sieben Pfund, und ein Erwachsenen fast zwanzig Pfund von diesem Reis essen müsste, um auf die empfohlenen Tagesdosis von Vitamin A zu kommen. Da ist es allemal einfacher, neben den Reisfeldern Gemüse anzubauen, das reich an Vitamin A – und noch weiteren wertvollen Stoffen ist.
Generell ist es sinnvoller, verschiedene Nahrungsmittel intelligent zu kombinieren, anstatt zu versuchen, mittels Gentechnik möglichst viele Inhaltsstoffe in einem Nahrungsmittel zu vereinen. Der Versuch, Hülsenfrüchte mit Genen aus Getreide aufzuwerten ist müßig – die Schwaben haben schon vor Langem ein solches Verfahren erfunden. Es nennt sich: Linsen und Spätzle. In Südamerika ist es die Kombination von Bohnen und Mais und in Asien Soja und Reis, die eine positive Eiweißbilanz liefert. Ohne Herumfummelei an den Genen.
Wer will denn ernsthaft eine Art Tomatenbohnenmaiskartoffel, die alle Inhaltsstoffe in sich vereinigt? Wer möchte denn ernsthaft auf den sinnlichen Genuss verzichten, den eine phantasievolle und liebevoll zubereitete Mischung verschiedener Nahrungsmittel bereiten kann? Auch die Propagandisten der Gentechnokratie mit Sicherheit nicht.
Wenn alle anderen nichts fruchten, ziehen die Gentechnologen als letztes Argument gewöhnlich den Spruch aus dem Hut, dass man die Gentechnik brauche, um die Hungernden zu sättigen und die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung zu sichern. Aber auch das ist nur PR-Geschwätz.
Zum einen bringen die gentechnisch veränderten Pflanzen weder mehr Ertrag, noch mehr Nahrungsqualität, zum anderen sind sie viel zu teuer, um von den Armen der sogenannten 3. Welt erworben zu werden. Ihr Anbau lohnt sich dort nur, wenn man sie zu Weltmarktpreisen in die Industrienationen exportieren kann, wo sie dann im Futtertrog der Massentierhaltung landen, um sich in Steaks und Schnitzel zu verwandeln. Und eben dies ist eine der Ursachen, warum es an manchen Orten zuwenig Nahrung gibt: die Verschwendung wertvoller pflanzlicher Proteine an Tiere.
Um eine Fleischkalorie zu erzeugen braucht man – im Durchschnitt – sieben Pflanzenkalorien. Mit anderen Worten: wo mit pflanzlicher Nahrung sieben Menschen satt werden, wird es beim Umweg über Fleischnahrung nur noch einer. Und der sitzt gewöhnlich in einem der nördlichen Industrieländer, während in den südlichen Entwicklungsländer die Menschen neben den vollen Getreidefeldern verhungern.
Nicht Gentechnik kann hier abhelfen, sondern nur ein Umdenken. Eine Änderung unserer Ernährungsgewohnheiten, von der übertriebenen Fleischmast – die uns ja gesundheitlich mehr schadet als nützt, denn proportional zum Fleischkonsum steigt auch das Darmkrebsrisiko – zu einer fleischreduzierten Vollwertkost beispielsweise. Und im politischen und sozialen Bereich eine gerechtere Verteilung der vorhandenen Ressourcen.
Alles in Allem muss man heute sagen: die Gentechnik schadet mehr, als sie nützt. Einen wirklichen Vorteil davon haben nur die Konzerne, die sie praktizieren und propagieren und viel Geld damit verdienen. Den Landwirten bringt sie auf die Dauer keinen Vorteil, und den Konsumenten ebenso wenig. In Polen hat gerade das Parlament den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verboten, in der Schweiz haben die Bürger per Volksentscheid ein Verbot durchgesetzt, und auch in Österreich werden keine GVO’s angebaut.
Mit Recht sind 79 Prozent der Bundesbürger gegen gentechnisch veränderte Nahrung, und selbst der bayerische Bauernverband hat sich gegen den Anbau von Gen-Mais ausgesprochen. Seltsamerweise hat die neue Bundesregierung entgegen diesem Trend sich entschlossen, die Gentechnik zu fördern, und es gibt Bestrebungen in der CDU, das Gentechnikgesetz zu ändern und zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht von Gentech-Produkten zu verwässern. Landwirtschaftsminister Seehofer hat bereits im vergangenen Jahr den kommerziellen Anbau verschiedener Sorten von Gen-Mais genehmigt. Was hat ihn dazu motiviert? Woher bezieht er bei 79prozentiger Ablehnung seine politische Legitimation? Aus dem „Wählerwillen“ doch wohl kaum.
Für 2006 waren in Deutschland etwa 1700 Hektar für den Anbau von Gen-Mais angemeldet, 98 Prozent davon in den „Neuen Bundesländern“.
Beantragt ist auch die Freisetzung von Kartoffeln, die Gene aus Cholerabakterien und einem Virus enthalten, das eine tödliche Krankheit bei Kaninchen hervorruft. Ebenso von einem Weizen, der durch Giftgene gegen Pilzbefall geschützt sein soll. Und im Hintergrund lauern immer noch die bislang verbotenen „Terminatorpflanzen“, deren Samen gentechnisch sterilisiert wurden.
Wollen wir Cholerapommes mit Hepatitisketchup? Wollen wir unsere Gebete ändern, im Sinne von: „Unser täglich Gift gib uns heute, und vergib unseren Vergiftern ihre Schuld?“ Wollen wir zulassen, dass Pflanzen angebaut werden, die Sterilitätsgene in die Natur verstreuen, mit völlig unkalkulierbaren Folgen?
Die englische Biochemikerin Professor Mae-Wan Ho, eine engagierte Kritikerin des Gentechwahns meinte: „Wir müssen diesen Dingen jetzt Einhalt gebieten. Es gilt, keine Zeit zu verlieren.“ Und ich stimme ihr zu.
Wir brauchen die Gentechnik so nötig wie einen Kropf. Sie ist ebenso überflüssig wie schädlich. 99 Prozent der gentechnischen Veränderungen an Pflanzen betreffen den Einbau von Pestizidgenen oder von Resistenzgenen gegen Pestizide.
Die Gentechnik in ihrer heutigen Form ist ein Teil der fatalen „Kampf gegen die Natur“-Strategie, die schon in der konventionellen Landwirtschaft zu Umweltschäden, Artensterben und einer zunehmenden Vergiftung von Wasser und Nahrung geführt hat, einer Strategie, die vom Kern her falsch ist und keinen Erfolg haben kann. Denn die Natur ist immer stärker, und mit all dem Gift, das verstreut wird, vergiften wir uns letzen Endes nur selbst.
Die einzig vernünftige Alternative zu diesem Unsinn liegt meiner Meinung nach in der ökologischen Landwirtschaft, in Lebensformen, die mit der Natur kooperieren, statt sie zu bekämpfen.
Was aber können wir tun? Von der Politik ist ebenso wenig Hilfe zu erwarten, wie von der Wissenschaft, die sind zu sehr von den Geldern der Industrie korrumpiert. Was hier hilft, ist einzig Konsumverweigerung. Die Hausfrau an der Supermarktkasse hat derzeit mehr Einfluss auf den weiteren Verlauf der Evolution als alle großen Geister. Kein Industrieunternehmen produziert Dinge, die es nicht verkaufen kann.
Wenn ein Konzern sich zur Gentechnik bekennt, wenn Anbieter von Milchprodukten, wie Greenpeace dokumentierte, ihre Kühe mit Gentechgetreide füttern, dann braucht man einfach nur Produkte anderer Hersteller zu kaufen. Es gibt für alles Alternativen, meist im gleichen Supermarktregal, schlimmstenfalls eines daneben.
Das Biosiegel ist – Gott sei Dank noch – eine ausreichende Garantie für gentechnikfreie Produkte. Und alle großen Supermarktketten haben inzwischen Bioprodukte im Angebot, Aldi und Norma, Plus und Edeka, Tengelmann und Lidl – und die Preise sind nicht wesentlich teurer. Das eine kaufen, und das andere liegen lassen – hierin liegt die Chance zu einer wirklichen Erneuerung auf basisdemokratischem Wege. Und das lohnt sich. Nicht nur weil wir alle davon profitieren, sondern auch einfach deshalb, weil wir damit all diesen arroganten Eierköpfen eine Nase zeigen könne, die glauben, sie könnten über uns und unser Leben bestimmen.
Buchempfehlungen:
Jeffrey M. Smith, „Trojanische Saaten“, Riemann (ISBN: 3570500608).
Mae-Wan Ho „Das Geschäft mit den Genen“, Diederichs (ISBN: 3424014966).
Manfred Grössler „Gefahr Gentechnik – Irrweg und Ausweg“ Concord (ISBN: 3950188711)
John Robbins „Food Revolution“ Hans-Nietsch-Verlag (ISBN: 3934647502)
Internet:
Pro-Gentechnik:
www.gruene-biotechnologie.de
www.transgen.de
www.isaa.org
Genkritisch:
www.greenpeace.de
www.genfoodneindanke.de
www.umweltinstitut.org
www.abl-ev.de
www.oeko.de
www.umweltbund.eu/deutsch/gentechnik.html
Zurück zum Anfang
Zurück zum Inhalt
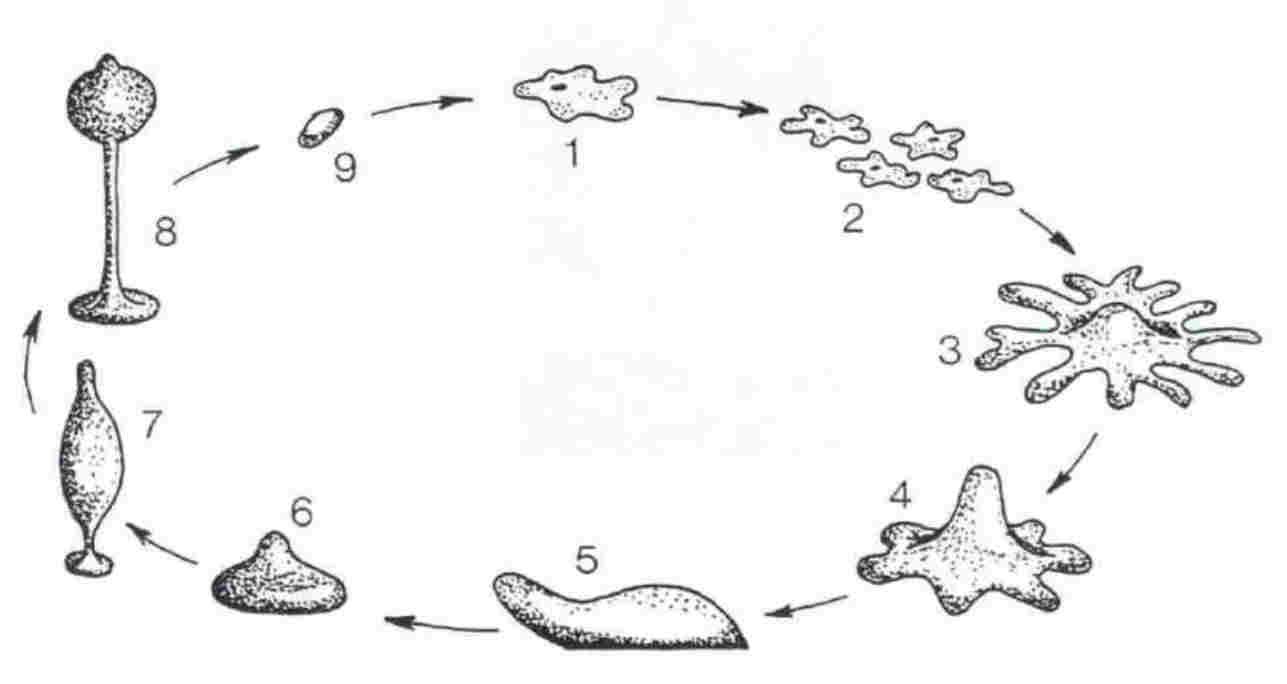
 “Es gibt noch soviel zu erforschen...”, meint sie.
Und dabei hat sie schon sehr viel erforscht und herausgefunden: seit über 50 Jahren untersucht sie die Einflüsse kosmischer Kräfte auf das Wetter und das Wachstum von Pflanzen. Und sie entwickelte auf Grund ihrer Erfahrungen eine sehr erfolgreiche Methode der ökologischen Gartenbearbeitung, mit der sich Ertrag und Qualität von Nahrungspflanzen erheblich steigern lassen.
“Es gibt noch soviel zu erforschen...”, meint sie.
Und dabei hat sie schon sehr viel erforscht und herausgefunden: seit über 50 Jahren untersucht sie die Einflüsse kosmischer Kräfte auf das Wetter und das Wachstum von Pflanzen. Und sie entwickelte auf Grund ihrer Erfahrungen eine sehr erfolgreiche Methode der ökologischen Gartenbearbeitung, mit der sich Ertrag und Qualität von Nahrungspflanzen erheblich steigern lassen. 
 Aussaat und spätere Pflegearbeiten sollten also an den Tagen erfolgen, die dem jeweiligen Pflanzentyp entsprechen:
Aussaat und spätere Pflegearbeiten sollten also an den Tagen erfolgen, die dem jeweiligen Pflanzentyp entsprechen:  Aussaat und Pflege zum richtigen oder falschen Zeitpunkt ergaben in Maria Thuns Versuchen Ertragsunterschiede von beispielsweise etwa 30 Prozent beim Spinat und teilweise bis zu 40 % bei Radieschen!
Aussaat und Pflege zum richtigen oder falschen Zeitpunkt ergaben in Maria Thuns Versuchen Ertragsunterschiede von beispielsweise etwa 30 Prozent beim Spinat und teilweise bis zu 40 % bei Radieschen!